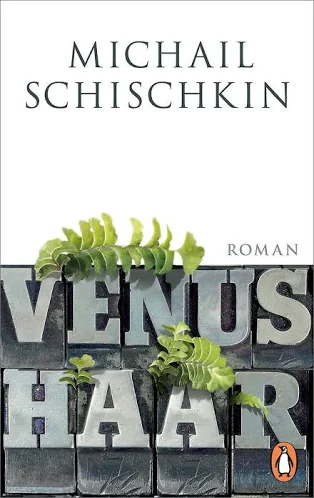Rezensionen und Interviews
Michail Schischkin: “Man dient in Russland nicht dem Gesetz, sondern dem einen Boss”
Interview von Stefan Boss. “Tageswoche”, 29.3.2015
“Wenn man liebt, kann man nicht ganz sterben”
Interview mit Michail Schischkin
Von Iris Muhl. AZ, 23.02.2012
Leben in seiner absurden Erscheinungsform
Von Karlheinz Kasper. “Osteuropa” 1/2012
Tschetschenien, eine antike Tragödie
Von Fokke Joel. “Die Zeit”, 27.07.2011
Gogol tanzt und fuchtelt mit dem Regenschirm
Von Lothar Müller. “Süddeutsche Zeitung“, 20.07.2011
Von Richard Kämmerlings. “Die Welt”, 02.07.2011
Von Michael Stavarič. “Die Presse”, 01.07.2011
Internationaler Literaturpreis: Michail Schischkin: Ein Sturm weht vom Paradiese her
Von Bettina Kaibach. “Tagesspiegel”, 29.06.2011
Internationaler Literaturpreis für den Roman Venushaar: Ein Gespräch mit Michail Schischkin und seinem Übersetzer Andreas Tretner
Von Ekkehard Knörer. “Der Freitag”, 06.2011
Brandwunden aus der Einwanderungsbehörde
Von Eva Pfister. “Stuttgarter Zeitung”, 17.06.2011
Von Eva Pfister. WOZ, 16.06.2011
Der neue Tolstoi lebt in Zürich
Von Guido Kalberer. “Tagesanzeiger”, 11.06.2011
von Olga Hochweis. Deutschlandfunk Kultur, 11.05.2011
Von Ralph Dutli. NZZ am Sonntag, 24.04.2011
Exlibris, ORF Radio Ö1, 24.04.2011
“In der Schweiz habe ich mich als Autor gefunden”
Von Marco Guetg. “Der Sonntag”, Nr.13, 3.04.2011
Von Ulrich M. Schmid. NZZ, 12.03.2011
Das Ministerium für Paradiesverteidigung
Von Dominik Riedo. “Schweizer Monatshefte”, Januar 2011
Von Ijoma Mangold. “DIE ZEIT” Nr.13/2013, 21.03.2013
EUROPA-JOURNAL, 24. AUGUST 2012
Beim Übersetzen von fremdem Leid
Von Karla Hielscher. Deutschlandfunk Kultur, 21.04.2011
Von Ivona Jeicic. “Tiroler Tageszeitung”, 10.09.2011
Der Roman als Dolmetsch eines russischen Jahrhunderts
Von Wolfram Schütte. TITEL Kulturmagazin. 16. Juni 2011
Michail Schischkin: “Man dient in Russland nicht dem Gesetz, sondern dem einen Boss”
Der russische Erfolgsautor Michail Schischkin (Venushaar) lebt seit 20 Jahren in der Schweiz. Der unerschrockene Putin-Kritiker zieht Parallelen vom heutigen Russland zu Nazi-Deutschland im Jahr 1935. Liebe, Freundschaft und gute Literatur vermögen aber auch in dunklen Jahren das Licht aufscheinen zu lassen, findet er.
Interview von Stefan Boss
Wir suchen Michail Schischkin an einem sonnigen Märztag bei sich zu Hause im beschaulichen Kleinlützel (SO) auf. Das Dorf liegt nur ein paar hundert Meter von der französischen Grenze an den Ausläufern der Blauenkette. Schischkin (54) bittet uns ins helle Wohnzimmer. Er wirkt zunächst etwas kühl, wird im Laufe des Gesprächs aber auftauen. Die untersten Tablare des riesigen Büchergestells, das völlig überquillt, hat er mit dünnen Holzplatten abgesperrt, um zu verhindern, dass sein eineinhalbjähriger Sohn Papas Bücher ausräumt. Während der Kleine im Kinderwagen auf der Terrasse schläft, serviert Ehefrau Schenja Tee.
Herr Schischkin, Sie sind in der Sowjetunion aufgewachsen. Ihre Mutter war Ukrainerin, ihr Vater Russe. Welcher Elternteil steht Ihnen näher?
Was soll diese Frage? Beide Eltern sind längst tot, und da auch ich mich dem Tod nähere, sind wir uns näher und näher (lacht).
Was würden Ihre Eltern über den Krieg in der Ukraine denken?
Zum Glück müssen sie nicht mehr miterleben, wie sich die beiden Brudervölker abschlachten. Mir tut es weh, das zu beobachten. Das Schlimmste ist, dass man etwas dagegen tun möchte, aber letztlich machtlos ist. Ich verstehe jetzt, was die deutschen Schriftsteller in den 1930er-Jahren fühlten. Hat die grosse deutsche Literatur den Krieg gestoppt? Nein! Hat die grosse russische Literatur den Gulag verhindert? Keineswegs! Die russische Literatur hat geholfen, im Gulag zu überleben, aber einen Krieg vermag die Literatur nicht zu stoppen. Thomas Mann und Stefan Zweig mussten mitansehen, wie das Volk jubelnd dem Führer in die Katastrophe folgte. Und auch jetzt erleben wir eine Katastrophe, und der Krieg ist ebenfalls da.
Befürchten Sie, dass es einen grossflächigen Krieg geben könnte?
Ja, in der Tat. Es gibt bereits einen russischen Faschismus, schauen Sie sich dieses Video an. (Er zeigt auf seinem Computer ein russisches Propaganda-Video mit dem Titel «Ich bin ein russischer Besatzer». Darin wird der Kolonialismus im alten Russland und in der Sowjetunion verherrlicht. Im Internet wurde es über fünf Millionen Mal angeklickt.)
Dieser Film ist in der Tat beängstigend. Trotzdem: Ist Ihr Vergleich mit dem Faschismus und Nazi-Deutschland nicht überzogen?
1935 gab es in Deutschland auch noch keine Konzentrationslager, und es gab noch keinen Krieg. Trotzdem war es ein faschistisches Land. In Russland kommen jetzt die späten Dreissigerjahre.
Emigranten, die enttäuscht sind von ihrer Heimat, neigen manchmal zu radikalen Ansichten. Sind Ihre Worte vielleicht so zu erklären?
Ich habe mich zunächst nicht als Emigrant gefühlt. Ich kam ja vor knapp 20 Jahren der Liebe wegen in die Schweiz. Ich behielt meinen russischen Pass und kehrte immer wieder zurück. Vor drei Jahren heiratete ich eine Moskauerin, und mit ihr verbrachte ich ein ganzes Jahr in der russischen Kapitale. Das war die Zeit der bürgerlichen Revolution, als es nach der gefälschten Dumawahl 2011 zu Massenprotesten kam. Die Macht zeigte uns aber nur ihren grossen Hintern. Seither geht es nur abwärts mit diesem Land. Ich sehe für normale Leute überhaupt keine Möglichkeit mehr, dort zu arbeiten. Deshalb fühle ich mich in der Tat als Emigrant.
Kürzlich wurde der Politiker Boris Nemzow in Moskau ermordet. Welche Rolle vermag die Opposition noch zu spielen?
Sie ist stark eingeschüchtert und weitgehend zerschlagen. 2011 kamen 200’00 bis 300’000 Personen an die Demonstrationen gegen das Regime. Da gab es grosse Hoffnung, weil sich in den letzten 20 Jahren eine bürgerliche Schicht herausgebildet hatte. Auch ich war an diesen Kundgebungen dabei. Die meisten Leute, die damals teilnahmen, sind inzwischen in den Westen übersiedelt.
Immerhin nahmen am Trauermarsch für Nemzow 50’000 Leute teil.
Ja, aber das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass in St. Peterburg und Moskau zusammen 20 Millionen Einwohner leben. Es tut mir weh, zu sehen, was in Russland passiert.
In einem offenen Brief im deutschen «Tagesspiegel» haben Sie geschrieben, Sanktionen gegen Russland würden Putin nicht zum Einlenken bewegen. Welchen Ausweg gibt es? Soll der Westen der Ukraine Waffen liefern?
Es existiert kein Rezept. Je mehr Waffen die Ukraine erhält, desto mehr Waffen wird auch die russische Seite einsetzen. Zurzeit ist ein Pokerspiel im Gang, in dem der Westen immer verlieren wird, weil er nicht bereit ist, die letzten Konsequenzen zu ziehen. Der Westen will keinen grossen Krieg, deshalb wird er immer zurückweichen. Im russischen Fernsehen wird dagegen offen erklärt, dass man auch einen Atomkrieg führen würde.
Was passiert, wenn Putin einmal weg ist?
In Russland gibt es eine feudalistische Pyramide: Man dient nicht dem Gesetz, sondern dem einen Boss. Diese Pyramide ist sehr stabil, ins Wanken kommt sie nur bei der Machtübergabe, weil dann die Clans gegeneinander zu kämpfen beginnen. Wenn Putin jetzt geht, kommt es zu einem Blutvergiessen, wenn er erst in 20 Jahren geht, wird das Blutbad noch viel grösser sein.
Sprechen wir von Ihrem literarischen Schaffen: Ihr grosser Roman Venushaar handelt von einem Dolmetscher, der in der Schweiz die Aussagen von russischsprachigen Asylbewerbern übersetzt. Sie waren früher selbst als Dolmetscher im Schweizer Asylverfahren tätig, haben Sie mit dem Buch persönliche Erfahrungen verarbeitet?
Sicher. Wenn man aus Russland in die Schweiz kommt, hat man den Eindruck, hier passiere nicht viel. Worüber soll ich in diesem langweiligen Land überhaupt schreiben? Das waren meine ersten Gedanken. Als Schriftsteller braucht man die Spannung, man braucht Geschichten, und die hat mir meine Tätigkeit als Dolmetscher geliefert.
Sie zeichnen die Asylbeamten als Menschen, die versuchen, kleinste Unstimmigkeiten in den Aussagen der Flüchtlinge zu finden. Erhielten Sie Reaktionen aus dem Bundesamt für Flüchtlinge?
Ja, sofort nach der Veröffentlichung des Buches auf Russisch im Jahr 2005 verlor ich den Job. Ich war nicht fest angestellt, man hat mir also einfach keine Aufträge mehr erteilt. Ich kann das irgendwie verstehen, welche Behörde möchte einen Schriftsteller als Mitarbeiter? Seither muss ich ausschliesslich von meinen Büchern leben. Am Anfang war es schwierig. Seit nun auch der Briefsteller, ein weiteres Buch von mir, übersetzt wurde, geht es besser. Insgesamt wurden meine Bücher in 30 Sprachen übersetzt.
In Venushaar beschreiben Sie in einem der Erzählstränge das Leben einer russischen Romanzensängerin, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Südrussland dem Ersten Weltkrieg dank der Liebe zu trotzen vermag. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die Idee, in meinem Roman die Tagebücher einer jungen Frau zu schildern, kam mir, weil mir meine Mutter ihre Tagebücher schenkte, als sie an Krebs erkrankte. Sie hatte ihre Jugend Ende Vierziger-, Anfang Fünfzigerjahre in der Nähe von Moskau verbracht. Das waren ja dunkle Jahre, noch unter Stalin. Ich erwartete, in ihrem Tagebuch von der Angst und von einer dunklen Atmosphäre zu lesen. Die Schilderungen sind aber durchdrungen vom Licht und von der Erwartung der grossen Liebe, die kommen muss, davon ist sie überzeugt. Sie ist absolut glücklich, weil das Wetter schön ist, die Freundinnen da sind, weil sie gute Bücher liest. Für mich war das wie eine Offenbarung. Dies ist ja keine Naivität eines Mädchens, sondern die einzige Überlebensmöglichkeit in finsteren Zeiten. Jemand hat dieses Mädchen auf die Welt geschickt, um die Welt durch seine Liebe zu retten. So wie er immer wieder solche Mädchen auf die Welt schickt. Das Tagebuch meiner Mutter hat mich inspiriert.
Der Roman ist wunderbar geschrieben, sehr vielschichtig, manchmal auch etwas ausufernd. Vom “Tages-Anzeiger” wurden Sie auch schon als neuer Tolstoi gefeiert. Wie verfasst man ein solches Epos?
Man kann sich nicht zum Ziel setzen, ein Epos zu verfassen. So wie man sich auch nicht vornehmen kann, ein Kind mit bestimmten Eigenschaften zu zeugen. Ich schreibe einfach das, was mir in einem bestimmten Moment meines Lebens entspricht. Der Text basiert auf meinem bisherigen Leben und auch auf dem meiner Eltern. Man kann im Kopf schon ein Konzept machen, die Hand wird aber stets etwas anderes schreiben.
Tolstoi hat seine Romane mehrfach überarbeitet und durch seine Frau in Reinschrift bringen lassen – machen Sie das auch?
Nein, meine Frau hat damit nichts zu tun, sie ist frei von dieser Aufgabe. Wenn ich etwas geschrieben habe, ist das wie aus Marmor, ich schreibe es nicht mehr um. Ich bin in dem Sinn nicht wie Tolstoj, aber er war ja ein Genie (lacht). Wenn ich schreibe, kommt der Roman jeweils zu mir und diktiert mir den Text. Ich muss nur aufmerksam zuhören und ihn aufschreiben.
Wie wurden Sie eigentlich aufgenommen, als sie 1995 wegen Ihrer ersten Frau in die Schweiz kamen?
Auf persönlicher Ebene gut. Innerlich war mir aber unwohl, ich fühlte mich wie in einer Wüste. Es fehlte mir die russische Kultur, deshalb musste ich eine Kolonie aufbauen. Ich schrieb einen russischen literarischen Reiseführer der Schweiz (Die russische Schweiz). Tolstoj, Rachmaninow, Bunin – sie weilten alle mal in der Schweiz – das waren meine Kolonisten. Dann fühlte ich mich zu Hause, und ich konnte meine Romane schreiben.
Können Sie zurzeit an einem neuen Roman schreiben?
Nein. Um ein Buch zu schreiben, braucht man eine innere Ruhe. Man schafft ja einen Kosmos. Wenn ich am Morgen aufstehe, mir die Nachrichten anschaue und lese, dass in der Ukraine wieder geschossen wird, dann kann ich nicht literarisch schreiben. Ab und zu vielleicht ein Essay, der von internationalen Zeitungen wie “The Guardian” publiziert wird. Wenn ich schweigen würde, hiesse das ja, dass ich einverstanden wäre. Das Einzige, was ich machen kann, ist nicht zu schweigen.
Sie waren im Oktober in Krasnojarsk in Sibirien. Hatten Sie keine Angst, in Russland wegen Ihrer kritischen Äusserungen behelligt zu werden?
Ich bin nicht der einzige Kritiker des Regimes. Die Liste der Regimefeinde ist lang – und ich stehe nicht zuoberst. Der Mord an Nemzow ist ein klares Signal, dass es auch andere Oppositionspolitiker wie zum Beispiel Alexej Nawalny treffen könnte.
Werden Sie wieder zurückkehren?
Zurzeit habe ich keine grosse Lust dazu. Wie soll ich mit Leuten, die sich freuen, dass die Krim besetzt wurde? Betrübt hat mich auch, was in den sozialen Medien nach dem Mord an Nemzow geschrieben wurde. Dieses Schwein habe den Tod verdient, und solche Dinge.
In der Schweiz wohnten Sie zunächst in Zürich, jetzt in Kleinlützel: Was hat Sie in die Provinz verschlagen?
Wenn man graue Haare bekommt und eine grosse Familie hat – meine Frau brachte zwei Kinder aus erster Ehe mit und wir haben ein gemeinsames Kleinkind – lebt man gerne im Grünen. Es ist eine schöne Gegend, auch zum Wandern. Zudem bin ich in einer halben Stunde am Flughafen. Das ist sehr praktisch, weil ich für meine Lesungen viel reisen muss.
Haben Sie trotz des düsteren Bildes, das Sie von Russland zeichnen, Hoffnung für die Zukunft?
Jeder Krieg ist irgendwann vorbei, und die Kultur überlebt immer. Während der schlimmsten Kriege wurden oft die besten Bücher geschrieben. Ich hoffe, dass ein junger Mann da ist, der ein Krieg und Frieden über unsere Zeiten schreiben wird.
“Wenn man liebt, kann man nicht ganz sterben”
Interview mit Michail Schischkin
Von Iris Muhl
AZ, 23.02.2012
Michail Schischkin, gilt der Prophet nichts im eigenen Land?
Doch. Man muss aber das Land verlassen. So war es mit meinen Büchern in Russland.
Dann werden Sie die Schweiz schon bald wieder verlassen, um hier bekannt zu werden?
Es ist nicht mein Ziel, bekannt zu sein.
Sie behaupten aber, die Schweiz sei ein langweiliges Land. Weshalb?
Für einen russischen Schriftsteller sollte eigentlich dieses Alpenland langweilig sein – ohne russische Geschichten, ohne russische Spannung. Aber durch meinen Job als Dolmetscher im Migrationsamt tauchte ich damals in das kochende Meer der russischen Geschichten auf.
Und vor kurzem sind Sie von Zürich nach Kleinlützel gezogen. Warum ausgerechnet an die Grenze?
Ich wollte schon seit langem auf dem Lande leben. Ich habe hier ein Haus gemietet. Ich kam nach Kleinlützel mit meiner neuen Frau und ihren zwei Töchtern. Und was die Grenzebetrifft, wir leben bereits im 21. Jahrhundert in einer Welt ohne Grenzen.
Inzwischen werden Ihre Romane in 25 Sprachen übersetzt. Warum haben Sie für das Buch Venushaar aber im deutschen Raum fünf Jahre nach einem Verleger gesucht?
Die deutschsprachigen Verlage haben jahrelang meine Romane abgelehnt. Das war deprimierend. Es gab immer die gleichen Antworten: «Der Roman ist zu anspruchsvoll für unsere Leser.» Ich konnte diese Arroganz gegenüber dem Leser nie verstehen. Warum wird das Publikum für dumm gehalten? Man kann doch die Leute nicht nur mit Fastfood bedienen. Es gibt auch Menschen, die Slow Food mögen, die verhungern, wenn sie nichts bekommen. Ins Deutsche übersetzt zu sein, ist etwas Besonderes für mich. Es war eine ganz neue Erfahrung: Ich konnte den Text lesen und dem Übersetzer Andreas Tretner helfen. Anders als die chinesische oder norwegische Übersetzung. In meinem Lebensraum Leser zu haben, ist die Bestätigung, dass ich hier existiere. Eine Übersetzung ins Chinesische beweist nichts.
In Russland haben Sie sämtliche Literaturpreise abgeräumt. Im Dezember sogar den Grossen Buchpreis von 100 000 Dollar für Ihren neuen Roman Briefsteller, der im Herbst auf Deutsch erscheint. Können Sie nun vom Schreiben leben?
Mein Leben lang habe ich für meine Bücher gearbeitet. Nun arbeiten sie für mich.
Schreiben ist ein einsamer Beruf. Wie halten Sie das aus?
Ich bin im bestimmten Sinne kein Berufsschriftsteller. Man sollte jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Buch auf den Markt liefern, fürs Fernsehen pfuschen, Kolumnen wöchentlich publizieren, für Zeitschriften in allen Ländern schreiben. Das mache ich alles nicht. Ich schreibe nur, wenn der Roman kommt. Und das macht er einmal in 5 bis 6 Jahren. Und dann muss ich alles aufgeben und schreiben. Das kann nicht jede Ehefrau aushalten. Meine Schreiberei hat mich zwei Ehen gekostet.
Ihr Job als Dolmetscher im Migrationsamt hat Sie geprägt. In Ihrem Buch Venushaar beschreiben Sie nun einen Mann namens «Dolmetsch». Was verarbeiten Sie?
Ja, das war ich auch – «der Dolmetsch in der Flüchtlingskanzlei des Ministeriums für Paradiesverteidigung». In meiner Funktion als Übersetzer wurde ich zum Bindeglied zwischen zwei im Grunde nicht kompatiblen kulturellen und mentalen Welten. Diese unterschiedlichen Welten wollte ich im Roman zusammenführen. Alle Menschen sind doch «kompatibel»: wir sind Liebe, Tod, Unsterblichkeit.
Unsterblichkeit?
Jeder hat Erfahrungen mit der Liebe, mit den Kindern, der Familie. Jeder hat den Tod der nächsten Menschen erlebt. Keiner will daran glauben, dass er einmal verrecken muss.
Im Buch beschreiben Sie die zerbrechende Liebe des Dolmetsch und seiner Frau Isolde. Ist es besonders schmerzhaft, über eine vergangene Liebe zu schreiben?
Das Venushaar ist eine Liebesgeschichte. Die Geschichte der Liebe und deren Scheitern. Der Dolmetsch liebte seine Frau Isolde, aber zwischen ihnen war noch Tristan, Isoldes erste Liebe, die in einem Autounfall ums Leben gekommen war. Wenn man liebt, kann man nicht ganz sterben.
Leben in seiner absurden Erscheinungsform
Russische Literatur in Erst- und Neuübersetzungen 2011
Von Karlheinz Kasper
Endlich wieder große Romane. Sie sind auf dem deutschen Buchmarkt seltener geworden – die großen Romane aus Russland, die den Leser in ihren Bann ziehen wie die Werke von Gogol´ und Gončarov, Tolstoj und Dostoevskij, von denen Thomas Mann sagte, sie gehörten zu den unsterblichen Werken der Weltliteratur. Dabei ist der anspruchsvolle Roman auch in der russischen Gegenwartsliteratur präsent, nur dass er nicht immer in Moskau oder Petersburg entsteht, sondern häufig in New York, Frankfurt oder Zürich.
Michail Šiškin (*1961) lebt seit 1995 in der Schweiz und hat dort Romane verfasst, mit denen es ihm gelang, der russischen Literatur jene Weltgeltung zurückzuerobern, die sie im 19. Jahrhundert mit den genannten Autoren oder im 20. Jahrhundert mit Bulgakov und Nabokov besaß. Die Eroberung Izmails wurde 2000 mit dem russischen Bookerpreis ausgezeichnet, Venushaar 2005 mit dem Preis Nationaler Bestseller. In Deutschland hat es sehr lange gedauert, bis Šiškin für den Roman Venushaar mit der Deutschen Verlags-Anstalt in München den ersten Verleger und mit Andreas Tretner einen hervorragenden Übersetzer fand.
Šiškins Figuren bewegen sich in einer universalen Welt der Kultur, die keine geographischen und nationalen Grenzen kennt. Das gilt auch für die zentrale Figur von Venushaar. Der Dolmetsch (tolmač), ein gebürtiger Russe, lebt in der Schweiz, hilft der Kantonspolizei im Auffangzentrum Kreuzlingen, der „Flüchtlingskanzlei des Ministeriums für Paradiesverteidigung“, bei der Befragung von Asylbewerbern. Er übersetzt die Fragen des kaltherzigen Beamten „Petrus“ nach den Gründen für den Asylantrag und die Antworten der osteuropäischen „Gesuchsteller“, die im „Paradies“ leben möchten und phantastische Geschichten erfinden, damit ihnen Einlass gewährt wird.
Jede Geschichte handelt von Menschen, die durch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts entwurzelt wurden. Ihre Aussagen wabern nach der Arbeit im Kopf des Dolmetsch weiter und multiplizieren sich bis zur Unendlichkeit. Der Dolmetsch speichert sie und wird zum Generator neuer Geschichten. Der Autor vergleicht diese Tätigkeit mit der des florentinischen Malers Luca Signorelli, der die Fresken Auferstehung des Fleisches im Dom zu Orvieto schuf:
„Aus dem Nichts, aus der Leere des Raumes, aus dem grauen Putz, aus dem dichten Nebel, aus einer Fläche Schnee, aus dem weißen Blatt Papier tauchen plötzlich Menschen hervor, erstehen lebendigen Leibes, und dies, um für immer zu bleiben . . . Und wo die Dimensionen aufeinanderstoßen, kippen die Wand, der Schnee, der Nebel, das Papier in die Zeit.“
Der Dolmetsch generiert weitere Handlungsstränge, erzählt von der Schulzeit in Moskau und der Lehrerin Galina Petrovna, von der Ehe mit Izol’da und der Geburt des Sohnes, vom späteren Leben in der Einzimmerwohnung gegenüber dem Friedhof, von der Reise nach Rom und dem Versuch, die Ehe zu retten, die an seiner Eifersucht gegenüber einem Toten (Izol’das verunglücktem ersten Mann Tristan) scheitert. Der Dolmetsch schreibt Briefe an seinen Sohn, der ihm lustige Zeichnungen schickt und es cool findet, dass er von zwei Vätern Weihnachtsgeschenke erhält. Unversehens schleichen sich in diese Briefe haarsträubende Asylantenschicksale ein. In der Freizeit liest der Dolmetsch Xenophons Anabasis, den Bericht über den Feldzug des Kyros gegen seinen Bruder Artaxerxes und den Rückzug des griechischen Heeres bis an das Schwarze Meer. Xenophons Text vermischt sich mit der Asylantenbefragung, der Familiengeschichte und den Briefen an den Sohn. Aus der Erinnerung an den ersten Auftrag, den der junge Moskauer Schriftsteller von einem Verlag bekam, erwächst die Geschichte der Romanzensängerin Izabella Jur’eva, deren Tagebuch den Ablauf eines privaten russischen Frauenlebens, Liebe, Eifersucht und Verrat, in der Epoche der Kriege, Revolutionen und Terrorprozesse schildert.
Šiškin baut keine lineare Handlung auf, er bedient sich der „Matrëška“-Komposition, die schon Nabokov favorisiert hat. Venushaar ist ein Großtext, in dem fünf Texte wie russische Holzpuppen ineinander stecken – die Dialoge mit den Gesuchstellern, die Bruchstücke der Vita des Dolmetsch, die Vaterbriefe, Xenophons Anabasis und das Tagebuch der Sängerin. Jeder Text enthält Teile der anderen. Dazu kommen zahllose direkte oder versteckte Zitate aus bekannten und unbekannten Werken der Weltliteratur.
Andreas Tretners Anmerkungen zum Roman verweisen auf die Bibel, Mythen und Märchen, Werke der griechischen und lateinischen Klassiker, Krimi- und Fantasy-Autoren, Puškin, Lermontov, Gogol’, Dostoevskij, Tolstoj, Čechov, Esenin, Brodskij und weitere Quellen. „Matrëška“-Komposition und Intertextualität prägen die polyphone Erzählweise des Romans, die am Ende in ein kaum noch differenzierbares Stimmenorchester, ein erzählerisches Tutti, übergeht. Nicht ohne Grund sagt Galina Petrovna zum Dolmetsch, er sei ein großer Wirrkopf, bringe alles durcheinander, werfe alles in einen Topf. Venushaar, 2002/04 in Zürich und Rom geschrieben, ist ein Hymnus auf die Allmacht des Wortes. Šiškin vergleicht das Dichterwort mit dem Venushaar aus der Gattung der Frauenhaarfarne, das „durch alle Leinwände stößt“ und „jeden Marmor bricht“.
Tschetschenien, eine antike Tragödie
Der russische Autor Michail Schischkin schildert in Venushaar die Lage der Asylbewerber aus der ehemaligen Sowjetunion. Dafür bekam er in diesem Jahr den Internationalen Literaturpreis.
Von Fokke Joel
In Russland ist Michail Schischkin, der seit 1995 in der Schweiz lebt, ein bekannter Autor. 2000 wurde ihm für Die Eroberung Ismails der Booker-Preis für den besten russischen Roman des Jahres verliehen. Davor hatte er bereits den Preis für das beste Debüt gewonnen. In Deutschland dagegen ist Schischkin auch nach drei veröffentlichten Büchern ein weitgehend unbekannter Autor geblieben. Nach dem aber nun sein Roman Venushaar auf Deutsch vorliegt und er und sein Übersetzer Andreas Tretner für dieses Buch den Internationalen Literaturpreis 2011 des Berliner Hauses der Kulturen der Welt gewonnen haben, dürfte sich das ändern.
Denn auch wenn der Preis noch wenig bekannt ist, der Roman wird mit Sicherheit viele Leser finden. Das liegt vor allem daran, dass dem 1961 in Moskau geborenen Autor der Spagat zwischen anspruchsvoller und spannender Literatur gelungen ist. Venushaar ist ein Roman, in dem in mehreren Erzählsträngen auch formal kunstvoll Alltag und Mythos, russische Geschichte und Gegenwart miteinander verknüpft werden.
Das Buch beginnt mit einer Szene bei der Schweizer Fremdenpolizei. Ein Dolmetscher übersetzt die Antworten von Flüchtlingen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die in der Schweiz Asyl beantragen wollen. Stoisch listet Schischkin die Fragen des Beamten und die Antwort des “Gesuchestellers” auf. Für den Asylbewerber käme es dabei darauf an, so der Autor in einem Text, den er über seine eigene Zeit als Dolmetscher für die Schweizer Fremdenpolizei geschrieben hat, dass die Antworten glaubwürdig wirken. Meistens habe der Asylbewerber nichts von dem erlebt, was er erzählt, aber vielen anderen sei es so ergangen. Es käme darauf an, dass es in den Augen des Beamten der Fremdenpolizei so gewesen sein könnte. “Die Wörter schaffen die Wirklichkeit und entscheiden über das Schicksal.” Genauso, sagt Schischkin, wie in der Literatur.
In der Realität, erfährt der Leser von Venushaar, ist dieses Frage- und Antwortspiel meist kurz und endet mit dem Stempel “Prioritätsfall”, ein “beschleunigtes Verfahren in Anbetracht nahe liegender Abweisung”. In Schischkins Roman verselbstständigen sich jedoch die Geschichten der “Gesuchesteller”. Im Wechsel von Frage und Antwort spinnt er die Befragungssituation bei der Polizei weiter und aus den Asylbewerbern werden in den Augen des Beamten Barbaren, deren Heer “wie eine dunkle Kruste die Erde überzieht” und die Schweizer zu den sich gegen sie erwehrenden Helenen. Oder sind die Asylbewerber die Kämpfer von Kyros, der erfolglos gegen den Bruder Artaxerxes um die Nachfolge auf dem persischen Königsthron kämpft? Die Geschichte von Daphnis und Cloe wird erzählt, nach der die Berichte eines der “Gesuchesteller” klingen. Und die Berichte über die Folgen des Tschetschenienkriegs nehmen die Form einer antiken Tragödie an.
Schischkin gelingt in diesem Teil seines Romans diese Parallelisierung ohne eine harmonisierende Ästhetisierung. Die Widersprüche bleiben bestehen, die Wunden werden nicht geschlossen und regen den Geist zur Reflexion an. Gespannt liest man weiter und gelangt von einer Geschichte zur nächsten. In einem weiteren Teil des Buches erfährt der Leser dann die private Geschichte des “Dolmetsch”, wie ihn Schischkin sarkastisch entsprechend seines rein funktionalen Charakters nennt. Man erfährt von seinen Zweifeln, von der ihn in den zahllosen übersetzten Gesprächen quälenden Frage, ob man glücklich sein darf, wenn andere unglücklich sind. Man erfährt von seiner Liebe zu einer Frau, mit der er ein Kind hat und die er Isolde nennt. Und man erfährt davon, wie diese Liebe scheitert, weil es einen Tristan gibt, einen Mann im Leben Isoldes, der nicht verschwinden will, obwohl er schon lange tot ist.
In einem weiteren Teil des Buches hat sich Schischkin in eine Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Rostow am Don heranwachsende Frau versetzt. In Tagebucheintragungen, die kaum von authentischen Aufzeichnungen zu unterscheiden sind, erzählt er eine an das Leben der russischen Romanzensängerin Isabella Jurjewa angelehnte Lebensgeschichte. Eine Frau, die wie Isabella Jurjewa das ganze russische zwanzigste Jahrhundert repräsentiert, nicht nur, weil sie 1899 geboren wurde und im Jahr 2000 starb, sondern weil sie gleichzeitig die viele Höhen und Tiefen dieser Zeit erlebt hat.
Ob es das Tagebuch der jungen Sängerin ist, die von Liebe und Erfolg träumt oder der ins Groteske ausufernde Dialog auf der Fremdenpolizei: Michail Schischkin gelingen alle diese Schreibweisen. Das gilt auch für den Bewusstseinsstrom am Ende des Buches, in dem in Rom, der Stadt, wo Vergangenheit und Gegenwart ineinander verschmelzen, eine Reihe der Erzählstränge zusammenfließen. Schischkin versetzt sich überzeugend in den zwischen den Stühlen sitzenden russischen Emigranten hinein, in den verlassenen Mann und die liebende Frau. Er verbindet den Stil der großen Realisten seiner russischen Heimat, wie Turgenjew oder Tolstoj, mit der Auflösung linearen Erzählens. Dabei bleibt Venushaar auch für den, der kein Freund des modernen Romans ist, ein spannend zu lesendes Buch. Und für den, der Freude an den vielen Anspielungen hat, ein Roman, den er mehrmals lesen kann, weil er immer neue Aspekte der Geschichte entdeckt.
Gogol tanzt und fuchtelt mit dem Regenschirm
Die Kunst und die toten Seelen der russischen Geschichte zwischen 1917 und dem Tschetschenien-Krieg: Michail Schischkins Roman Venushaar
Von Lothar Müller
“Süddeutsche Zeitung“, 20.07.2011
Mit einer Legende hat nach der russischen Revolution des Jahres 1917 ein Museumsdirektor die Kunstsammlungen des Grafen Scheremetew aus dem 18. Jahrhundert im Landgut Ostankino bei Moskau vor allen Attacken geschützt. Das Palais sei von Leibeigenen geschaffen worden, das Museum also ein „Museum für die Kunst der Leibeigenen“. Michail Schischkin, der 1961 in Moskau geboren wurde, hat als Schulkind dieses Museum besucht. In seinem Roman Venushaar beschreibt er die kalten, dunklen Säle, die Kopie des Apoll vom Belvedere in den verschneiten Grünanlagen, und die schnurrbärtige Klassenlehrerin wird zu einer der Figuren, in denen sich die Erinnerung an Russland verdichtet.
Aber dieses Russland ist ferngerückt. Schischkin ist 1995 in die Schweiz ausgewandert, wo er seither lebt. Er hat selbst eine Zeitlang Protokolle von der Art angefertigt, wie sie den im Original 2005 erschienenen Roman eröffnen, hat als Übersetzer im Dienste der Schweizer Einwanderungsbehörden Lebensgeschichten erfragt und aufgeschrieben, die erzählt wurden, um einen Asylantrag zu begründen. Es sind Geschichten von Gewaltopfern aus Tschetschenien, aus Russland, aus dem Grenzgebiet zu Kasachstan.
„Der Dolmetsch“, so heißt im Roman die Figur, die Schischkins Erfahrungen in sich aufnimmt. Wie dem Dolmetscher seine Endung ist den Protokollen das Aktenzeichen abhanden gekommen. Der Sachbearbeiter mag mit bürgerlichem Namen Peter heißen, im Roman ist er Petrus, der darüber wacht, wer ins Paradies hinein darf, genauer gesagt, er hat einen Doppelgänger namens Petrus, der ihn und die Asylsuchenden aus der Amtsstube entführt, dorthin, wo früher die Erlösungsversprechen gegeben und am jüngsten Tag die Toten auf Himmel und Hölle verteilt wurden.
Von Beginn an lässt Schischkin keinen Zweifel daran, dass er die Bürokratie und den Schrecken der Geschichte nicht realistisch beschreiben, sondern durch die Einbildungskraft herausfordern will. Er überantwortet sie dem Geiste Nikolai Gogols, bei dem sich Wortendungen von ihrem Rumpf und ganze Riechorgane vom Körper lösen, dem sie angehören, bei dem aus Kanzleipapier und Statistiken tote Seelen aufsteigen und bei dessen Mummenschanz der heillosen Welt der Witz und das Grauen als unzertrennliches Paar Regie führen. Das Abtrennen von Körperteilen – von der Erinnerung an Ciceros Hände und Kopf, die am Forum Romanum zur Schau gestellt wurden, bis zu den Explosionen, die im Tschetschenien-Konflikt Zivilisten in einem Bus zerfetzen – ist in diesem Roman keine phantastische Allüre, sondern Teil der Realgeschichte, die er in sich aufnimmt.
Da sind die Soldatenzüge und Hinrichtungen aus der Anabasis des Xenophon, da sind die Geschichten von Gewalt, Vertreibung und Grausamkeitsritualen während des Ersten Weltkriegs und der Russischen Revolution, im Zweiten Weltkrieg und in der Stalinzeit, bis hin ins Tschetschenien und Ossetien der Ära nach dem Zerfall der Sowjetunion. In der Überblendung der Zeiten verliert aber kein Ereignis sein Eigenrecht. Den Toten des Massakers der Roten Armee in Chaibach 1944 bei der Deportation der Tschetschenen setzt dieser Roman einen massiven Grabstein.
Er hat aber von der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts auch gelernt, die Dämonen aus dem Alltag und der Fülle seiner Details hervorgehen zu lassen. So wird eine fiktive russische Sängerin, die 1899 geboren wurde und hochbetagt am Ende des Jahrzehnts starb, in dem die Sowjetunion zugrunde ging, zur heimlichen Hauptfigur des Romans. In Isabella Jurjewa (1899-2000) hat sie ein reales Vorbild. Ihr Tagebuch hat Michail Schischkin zu einem lebendigen Archiv der russischen Kunst im 20. Jahrhundert gemacht, der Puschkin- und Tolstoi-Treue ebenso wie des Aufbruchs in Theater und Kino, zu einem Album voller Liebesandenken und Backfischschwärmerei, zu einer privaten, bürgerlichen Geschichte vom Ersten Weltkrieg bis in die Sowjetunion nach 1945.
Die Erinnerung an das Ostankino-Russland und eine tieftraurige Liebesuntergangsgeschichte, in die Schischkin seinen Dolmetsch verstrickt und in der ein toter „Tristan“ höchst lebendig herumspukt, umrahmen die Zeitgeschichte des Zerfalls der Sowjetunion und ihrer Kriege von Afghanistan bis Ossetien. Schauplatz der Liebesgeschichte ist Rom, aber der Titel des Romans zitiert keine Liebesmythologie, er meint das Farnkraut, das durch die Ruinen wächst.
Gogol lebte zeitweilig in Rom, er hat in der Stadt der Toten und Statuen einen markanten Auftritt: „Wir bogen vom Palazzo Barberini nach links in eine Sackgasse, Gogol stimmte ein kleinrussisches Trinklied an, verfiel am Ende gar in einen Tanzschritt und fuchtelte mit seinem Regenschirm so gewagt in der Luft herum, dass keine zwei Minuten später nur noch der Schirmknauf in seiner Hand steckte, der Rest war beiseitegeflogen.“
Das Beiseitefliegen hat Schischkin zum poetischen Prinzip seines sprunghaften Romans gemacht, der oft seine Erzählstränge hart, übergangslos gegeneinanderschlagen lässt. Das Motto zitiert die apokryphe Offenbarung des Baruch: „Denn durch das Wort ward die Welt erschaffen, und durch das Wort werden wir einst auferstehen.“ Der Satz meint nicht nur die Wiedererweckung der in der Geschichte zugrundegegangenen Toten durch die Literatur. Er ist zugleich das ideale Motto eines Romans, in den ein Dolmetsch hineinführt.
Der Übersetzer Andreas Tretner stand vor der Aufgabe, einen ganzen Chor von Stimmen, eine Prosa- Polyphonie aus Bibelsprache und Verhörprotokoll, elegischer Liebesreminiszenz und hart-vulgärem Landserton, Palindromgirlanden und Wortspielen ins Deutsche zu bringen. Er hat für jeden russischen Topf einen deutschen Deckel gefunden, auch für die vielen Redewendungen, Merksätze und verballhornten Volksweisheiten, die dafür sorgen, dass in diesem Roman das komische Sprachregister nicht zu kurz kommt.
Vor kurzem haben Michail Schischkin und Andreas Tretner für Venushaar den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin erhalten. In Russland ist Schischkin ein vielgelesener Autor. Hierzulande ist er noch zu entdecken.
Hier erlöst der Autor selbst
Provozierende Heilsgeschichte: Michail Schischkins Roman Venushaar
Von Richard Kämmerlings
Das Handy klingelt. Der Tod ist dran. Herr Baumann von der Schweizer “Direktion für Soziales und Sicherheit” erwischt seinen Dolmetscher für die russischsprachigen Asylbewerber gerade im Urlaub in Rom. Herr Baumann nimmt dessen Dienste dennoch kurz in Anspruch, “nur ein paar Worte” solle der Dolmetscher per Telefon dem jungen Mann aus Minsk sagen, der weder Englisch noch Deutsch versteht. Der Bruder, ebenfalls Asylsuchender, sei im Durchgangszentrum ums Leben gekommen, vielleicht ein Unfall, vielleicht ein Selbstmord. “Andrej, pass mal auf. Dein Bruder Viktor…” Hinterher sagt Herr Baumann ein “Merci vielmals” für den fernmündlichen Todesbotendienst.
Michail Schischkins umfangreicher, gerade mit dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt ausgezeichneter Roman nimmt seinen Ausgangspunkt in der konkreten Realität unseres Migranten-Zeitalters. Schischkin, 1961 in Moskau geboren und 1995 in die Schweiz ausgewandert, hat selbst als Dolmetscher für die dortige Einwanderungsbehörde gearbeitet. Der Roman beginnt mit einer Reihe verhörartiger Interviews von “Gesuchstellern”, in denen die abenteuerlichsten Geschichten ausgebreitet werden, die alltägliche, sehr genrehafte Fiktion der Flüchtlingsromane: Pässe verloren, Heimatdorf niedergebrannt, alle Verwandten tot. Und obwohl die Baumanns dieser Welt durch ihre Fangfragen eine Legende nach der anderen enttarnen, bleibt ihre Wirkung auf den einzigen Zeugen, den Dolmetscher nämlich, gleich: “Diese Menschen, diese Reden – man wird sie nicht los”, schreibt er an seinen Sohn. Das tägliche, zur endlosen Elendsroutine gewordene Frage-und-Antwort-Spiel verselbstständigt sich, wird zum Panorama von Schicksalen quer durch Länder und Epochen und greift auf den Dolmetscher selbst über, dessen eigene Vergangenheit zum Stoff für einen hard-boiled -Thriller wird, wie ihn die russische Gegenwartsliteratur so massenhaft hervorbringt – mit Auftragskillern, explodierenden Autos und Verfolgungsjagden.
Der Auftakt dieses Romans ist schlicht großartig: Schischkin nimmt die einfache Interviewform, führt sie ad absurdum und erhebt sie zugleich zum Weltgericht, vor dem Autobiografisches, Historisches, Philosophisches und Theologisches gleichermaßen verhandelt werden. Was hier Selbstgespräch der Erinnerung, was platonischer Dialog, was Spiel mit der Romanform ist, ist nicht mehr auseinanderzuhalten.
Erst nach und nach kristallisiert sich aus diesem vielstimmigen Schicksals-Chor der Handlungsrahmen heraus. Der “Dolmetsch” genannte Erzähler verarbeitet die Trennung von seiner Familie. Seine Frau hatte einen früheren Geliebten bei einem Autounfall in Italien verloren; der Dolmetsch konnte nicht damit zurechtkommen, dass sie den Erinnerungen an diese Liebe weiter nachhing, und steigerte seine paradoxe Eifersucht auf den Toten bis zur Paranoia. Eine Italienreise lässt die Konflikte offen ausbrechen. Genau deswegen sitzt der Dolmetsch nun in Rom, betreibt selbstquälerische Trauerarbeit und schreibt an seinen Sohn. Nebenbei liest er in den Tagebüchern einer berühmten russischen Schlagersängerin, deren Biografie er vor langer Zeit einmal schreiben sollte. Beim Umzug ist er auf das längst vergessene Konvolut gestoßen, das ihm jetzt zum Lehrstück der menschlichen Existenz wird. Die Aufzeichnungen dieser Bella Dmitrijewna von frühester Jugend noch in der Zarenzeit an bis auf den Höhepunkt ihres Ruhms in der stalinistischen Ära erweitern Venushaar zur Jahrhundertchronik. Bellas Jugendliebe fiel im Ersten Weltkrieg. Diese frühe Begegnung mit dem Tod verbindet ihre Geschichte mit der des Dolmetsch – und mit den vielen drastisch vergegenwärtigten Gräueln der Geschichte, von der Antike bis zum Tschetschenienkrieg.
Schischkin hat einen Roman als universelle Totenklage geschrieben, die dem Schriftsteller die Rolle des Erlösers zuweist. Immer wieder wird Xenophons Geschichte des Bürgerkriegs im antiken Perserreich zitiert und fortgesponnen: “Bedenken Sie doch, wie viele Leute sind uns einfach durchgeflutscht, aber diese Griechen sind uns geblieben. Weil er sie verewigt hat.” Die Kunst hat die Aufgabe (und die Macht), den Tod in der Schrift zu überwinden. “Von Ihnen bleibt nur, was ich hier protokolliere”, lautet einmal die “Frage” an einen Veteranen, dem die Grenzen zwischen antiken Schlachten und kaukasischen Bürgerkriegen verwischen. So kommt es dann auch am Ende, in Rom, zu einem Triumph über die Vergänglichkeit, in einer eben so grandiosen wie unzeitgemäß-ungebrochenen Jenseitsvision.
Eine solche religiöse Wendung postmoderner Ästhetik hat ihren Preis, wie man in den schwächeren Passagen spürt. Denn wie die Handlung begrenzen, wenn jedes Detail und jede Figur der Rettung durch die Schrift bedürfen? “All das kann man vergessen. Zumal dann der Krieg kam und das Haus abbrannte und der Fotograf und alle anderen schon tot sind oder noch sterben werden. Wozu von ihnen erzählen?” Aber es wird eben doch von ihnen erzählt, so dass sich der oft von Hölzchen auf Stöckchen kommende Leser die gleiche rhetorische Frage wie der Autor stellt: “Wen könnte die Nummer eines nicht mehr vorhandenen Hakens in einer nicht mehr vorhandenen Garderobe interessieren?” Und auch Tod und Vergessen walten in der Weltgeschichte eben leider an jeder Ecke. So findet manche Länge ihren Grund in der Poetologie, was die Sache nicht unbedingt besser macht.
Das andere Problem ist die daraus folgende Selbsterhöhung des Künstlers zur Messiasfigur, die ja nicht nur in der russischen Literaturgeschichte ausreichend Vorbilder hat. Das “Venushaar” des Titels, eine Farnart, hat seinen Auftritt als wundertätiges “Kräutlein”, dem von höherer Stelle Kräfte zuwachsen sollen. Wie dem Roman selbst, dessen unerhörte Provokation darin liegt, dass er die christliche Heilsgeschichte fortschreibt und das ganz unironisch meint: Den Tod überwindet der Logos.
Wir sind, was wir sagen
Die Unmöglichkeit, die Welt zu verändern, jedoch die Lust, es zu versuchen, beide scheinen den Figuren des Romans Venushaar von Michail Schischkin auf den Leib geschneidert. Ein Frage-Antwort-Spiel auf höchstem literarischem Niveau.
Von Michael Stavarič
“Die Presse”, 01.07.2011
Michail Schischkin ist bis dato noch recht unbekannt im deutschsprachigen Raum – nicht so in Russland, wo er als bisher einziger Schriftsteller mit den drei wichtigsten Literaturpreisen des Landes bedacht wurde. Schischkin selbst übersetzte in der Schweiz (wo er heute lebt) jahrelang die Aussagen von Flüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion, was eine unerlässliche „Übung“ für die Figur des fiktiven Übersetzers in Venushaar darstellen musste. In seinem Roman verknüpft er nahezu alles miteinander, persönliche Schicksale (und sein eigenes), altrömische Kriegsberichterstattung, Sowjetgewalt in Tschetschenien, das Leben einer russischen Schnulzensängerin et cetera, alles spiegelt sich in allem. Doch der Reihe nach: War es nicht Milan Kundera, der einmal behauptete, wer noch so verrückt ist, Bücher zu schreiben, sollte dies so tun, dass man deren Inhalt nicht nacherzählen kann.
„Gesuchssteller“ und „Schickalslenker“, dies sind die beiden Welten, die einander in Schischkins Roman unentwegt begegnen – „und jeder ist ein Ministerium für sich, pardon, Mysterium“. Gesuchssteller (Asylanten also), die in der Schweiz Zuflucht suchen, stranden bei „Petrus“, dem mit seinem Stempel herumfuchtelnden, allmächtigen Beamten, der ihr Schicksal bestimmt. Der Protagonist in Venushaar ist Dolmetscher und selbst Emigrant, der es einst am strengen Petrus vorbeigeschafft hat und nunmehr der „Petrus’schen Behörde“ zur Hand geht. Im Schweizer Grenzort Kreuzlingen tätig, „betreut“ er russische Flüchtlinge, er betreibt sozusagen das „Frage-Antwort-Spiel“ auf Geheiß, sorgt für simultane Dialoge, versinkt selbst in den drastischen, zumeist realen Tragödien, die an den Grenzen der Realität rütteln, Lügen inkludieren.
Asylanten erzählen nun einmal Schauergeschichten, schinden Mitleid, wollen ins Paradies, doch kein Mitleid ist angebracht (selbst bei den haarsträubendsten Kriminalromanen), es geht schließlich stets um die Klärung von Sachverhalten, heißt es dort. „Und wenn man schon nicht hinter die Wahrheit kommt, sollte man zumindest die Unwahrheit erkennen.“ Zugleich deutet der Autor mithilfe seiner Figuren an (denn einiges dürfte hier autobiografischen Charakter haben), wie unerlässlich es sei, eine echte Geschichte zu erzählen, nichts dazuzuerfinden, denn „wir sind, was wir sagen“.
Das Buch ist gespickt mit Schicksalen in mehr oder minder restriktiven Systemen, politischen wie familiären. Die Suche nach Glück, Heil, Zuflucht, Nähe, es ließe sich beliebig weiter ausführen, dies alles sind erstrebenswerte „Umstände“, die Schischkins Figuren anziehen, ja, die bei Emigranten wohl einen hohen Stellenwert besitzen.
Der Russe erzählt seine Geschichten unkonventionell. Pathetisch-poetische Sprachbilder, im Stil und Duktus an Klassiker der russischen Literatur erinnernd (etwa Wenedikt Jerofejew, aber auch Dostojewski, Puschkin) werden nach und nach strukturiert – mit besagt gelungenem „Frage-Antwort-Spiel“. Die ewig gleichen Beamtenfragen münden nach und nach in skurrile Dialoge, bei denen längst nicht mehr klar ist, wer wirklich mit wem spricht, wo die Geschichte des Dolmetschers beginnt und wo die Schicksale diverser Asylanten enden; alles ist ein überbordendes Sammelsurium, ein Satz schöpft eine ganze Welt, der nächste schon ein neues Universum.
„Ein Baumknorren ist hüfttief ins Wasser gestiegen und fängt mit dem ausgestellten Ellbogen einen Kohlweißling. Hinter den Büschen ein Junge, der angelt. Irgendwo ein Stück flussabwärts knurrt ein Wolf, meckert eine Ziege, dazu das Knarren einer Rudergabel. Im Vordergrund schleppen die Datschenbewohner säckeweise Kohlköpfe vom Feld. Wer sich nicht erwischen lässt, ist kein Dieb. Jemand hat den Deckel eines Konzertflügels in seinen Zaun eingebaut. In dessen Schatten ringelt sich ein Schlauch, vom Wasser schwer. Was das Pärchen da im Sand am gegenüberliegenden Ufer treibt, ob sie sich küssen oder künstlich beatmen, ist von hier aus schlecht auszumachen.“
Dem Autor gelingt es mühelos, seine Leser in einen Sog aus Begebenheiten, Schlüsselmomenten und völlig unwichtigen, wenn auch reizvollen Exkursen zu reißen, allerdings geht man leicht in dieser Flut verloren. „Wo war das Untier?“, heißt es in einer der vielen dialogischen Sequenzen. Und die Antwort: „Sie sagten doch schon, es bestand aus Nebel.“ Die Unmöglichkeit, die Welt zu verändern, jedoch die Lust, es irgendwie zu versuchen, scheinen den Figuren des Romans auf den Leib geschneidert. Umso mehr sich die Geschichten verästeln, desto schwieriger wird es, die einzelnen Seiten zuzuordnen. Im Zweifel bleibt immer noch die Figur des Dolmetschers, dessen eigene Lebensgeschichte zusehends in unzähligen anderen Episoden aufgeht. Diese scheint kodiert, sodass sie die Kundigen zu erkennen vermögen, die anderen aber ein kleines Rätsel nach dem anderen zu lösen haben.
Es bleibt ein „Frage-Antwort-Spiel“ auf höchstem literarischen Niveau, in dem sich alles finden lässt. Zynismus, Ohnmacht, Pogrom, Kindheit, entzweite Familien, Zigeuner und in der Ferne schimmernde Paradiese. Es ist jedoch auch ein Buch, das in großartiger Manier die Angst dokumentiert, endgültig all das zu verlieren, was man zurücklassen musste beziehungsweise nie mehr aufzufinden, was man so dringend für sein „Sein“ benötigt. „Die Angst hört im Leben nicht auf, knurrt sie vor sich hin. Erst haben wir Angst, schwanger zu werden, dann vorm Gebären, und hinterher ängstigen wir uns um unser Kind bis ins Grab. Frage: Und als sie nach Hause kam, hatte sie das Kind verloren? Antwort: Ja.“
Und das „Venushaar“? Hierbei handelt es sich entweder um den Frauenhaarfarn (Adiantum capillus-veneris), ein graziles Pflänzchen, dessen Wedel einem kurzen, kriechenden Stämmchen entspringen, das mit gold- bis mittelbraunen häutigen Schuppen bedeckt ist. Eine Art, die keinen starken Frost verträgt, also unfähig, in Russland zu überdauern?! Oder geht es um den „Rutilquarz“? Dieser galt früher als eingefangenes Sonnenlicht und soll angeblich bei dunklem Gemüt und Husten helfen. Er ist ein „Hoffnungsträger“ und vermittelt Aufrichtigkeit, Unabhängigkeit und geistige Größe.
Wie dem auch sei – Michail Schischkins Literatur ist auch in unseren Breiten das Allerbeste zu wünschen. Hoffentlich lesen wir noch viel von ihm. Oder, um seinen vortrefflichen Übersetzer Andreas Tretner zu zitieren: „Es ist ein komplexes, monumental angelegtes, philosophisch wie ästhetisch nach den Sternen greifendes Buch.“ Man könnte noch hinzufügen: schön wild wuchernd!
Internationaler Literaturpreis: Michail Schischkin: Ein Sturm weht vom Paradiese her
Mit der Geschichte im Gepäck: Für seinen Roman Venushaar Michail Schischkin erhält den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt Berlin. Ein Porträt des in der Schweiz lebenden Russen.
Von Bettina Kaibach
“Der Tagesspiegel”, 29.06.2011
Lesen ist wie eine Bluttransfusion, sagt Michail Schischkin: Ein Buch kann Leben retten, aber auch töten, wenn sich die Blutgruppen von Autor und Leser nicht vertragen. Und er erzählt von einer Lesereise ins russische Provinznest Grjasowez, wo sich auch nach dem Fall der Sowjetunion nichts geändert hat – die gleiche Kluft zwischen offizieller Lüge und Alltagsrealität, die gleiche Armut, die durch das Geprotze der neuen Machthaber nur noch erniedrigender geworden ist. Wer in Grjasowez zur Autorenlesung in die Stadtbibliothek strömt, für den kann ein Buch in der Tat lebensrettend sein, meint Schischkin. Für Leute wie sie schreibt er seine Romane: für den Arzt, den Lehrer, die Bibliothekarin eines Grjasowez.
Schreiben als Blutspende fürs leidende Volk – für westliche Ohren mag das pathetisch klingen. In Russland hat solch literarischer Heilungsanspruch Tradition. Wo der Staat zum Schinder der eigenen Bevölkerung wurde, blieb es den Schriftstellern überlassen, die Wunden zu behandeln. Für ihren diagnostischen Scharfblick wurden sie ebenso verehrt wie verfolgt. Letzeres ist Michail Schischkin zum Glück erspart geblieben. Seit sein Erstlingsroman 1993 einen Preis für das beste Debüt des Jahres errang, befindet sich der Autor auf Erfolgskurs. So zuverlässig, wie seine Romane im Fünfjahrestakt erscheinen, werden sie in Russland mit höchsten Auszeichnungen bedacht.
Dem deutschsprachigen Publikum war Schischkin, der seit 1995 aus familiären Gründen in der Schweiz lebt, bislang nur als (ebenfalls preisgekrönter) Autor des literarisch-historischen Reiseführers Die russische Schweiz und einer literarischen Wanderung Auf den Spuren von Byron und Tolstoi bekannt. Im März ist nun – mit fünfjähriger Verspätung – sein Roman „Venushaar“ ins Deutsche übersetzt worden und hat gleich zwei Jurys überzeugt. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt wird er am heutigen Mittwoch mit dem Internationalen Literaturpreis prämiert, eine Auszeichnung, bei der zu Recht auch die Glanzleistung des Übersetzers Andreas Tretner mitbedacht wird. In der Schweiz erhält er im September den Spycher Literaturpreis Leuk.
Venushaar ist eine Farnpflanze, die gern auf feuchtem Mauerwerk wuchert. Tatsächlich lässt sich Schischkins Roman mit organischen Metaphern beschreiben: als Versuch, einer Welt Herr zu werden, die sich „ins Unendliche verzweigt, wie Kraut und Rüben aus dem Vorjahrsschnee herauswächst“. Den Leser erwartet ein schier unüberschaubares Gestrüpp ineinander verflochtener Schicksale. Jede Geschichte treibt wieder neue Geschichten aus sich hervor. Gestützt wird das wilde Geranke vom Gemäuer der kulturellen Überlieferung.
Im Städtchen Kreuzlingen an der deutsch-schweizerischen Grenze laufen die Fäden dieses Romangespinstes zusammen. Hier beginnt für Menschen, die in der Hoffnung auf Asyl weit gereist sind, die „beste aller Welten“, wo das Leben „ein lustig Liedlein“ ist. Und hier, in der „Flüchtlingskanzlei des Ministeriums für Paradiesverteidigung“, tut ein namenloser Dolmetsch, in dem wir unschwer ein Alter Ego des Autors erkennen, seinen Dienst. Für einen schweizerischen Petrus, bei dem Asylsuchende Einlass ins eidgenössische Paradies begehren, übersetzt er Verhöre mit russischen Landsleuten. In den Pausen liest er Xenophons Anabasis. Die Geschichte des versprengten Griechenheeres auf der Suche nach dem rettenden Meer liefert gewissermaßen den Urtext für die zahllosen Berichte von Krieg, Not, Vertreibung und die Sehnsucht nach dem verlorenen Eden.
Michail Schischkin hat selbst lange für die Kreuzlinger Empfangsstelle für Asylsuchende gearbeitet. In zwölf Jahren wurden dort 70 000 Personen befragt. Das sind 70 000 Geschichten, viele wahr, andere erfunden, in jedem Fall aber Dokumente epischen Leidens. Kein Wunder, dass der Dolmetsch von der Wortflut überwältigt ist: „Diese Menschen, diese Reden – man wird sie nicht los.“
In der Welt, aus der die Asylsuchenden geflüchtet sind und die sie nun noch einmal ausbreiten müssen, erscheint das Böse als eine allgegenwärtige Macht, die nicht zu greifen ist: ein Untier aus Nebel. Schischkin zeigt, dass unsere gängigen literarischen Erwartungen vor diesen Geschichten versagen: Was sich zunächst wie ein Krimi oder ein modernes Ritterepos liest, endet gerade nicht mit dem Sieg der Gerechtigkeit. Wo Korruption und Willkür herrschen, erwischt es früher oder später jeden, der aufbegehrt.
Was in diesem Schreckenspanorama sichtbar wird, ist nur die oberste Schicht. Darunter lagern Sedimente, die jederzeit wieder aufbrechen können. Etwa Tschetschenien. Dort überschatten die jüngsten Kriege ein anderes, längst nicht verwundenes Trauma: die blutige Zwangsdeportation hunderttausender Tschetschenen und Inguschen durch Stalin in den Jahren 1943/44. Schischkin ruft sie uns in Erinnerung, mitsamt den Namenslisten der Massakrierten. Die Überlebenden geleitet er schließlich gemeinsam mit Xenophons Griechen zum rettenden Meer. Die Gegenwart in Schischkins Roman gleicht einem Gang übers Eis: „Der Fuß kommt ins Schlittern, und es ist ungewiss, wo und wann man aufklatscht. Hast du nicht gesehen, steckst du im Russisch-Türkischen Krieg!“
Schischkin weiß, wovon er spricht. Seine Familiengeschichte ist geprägt von Gewalterfahrungen. Ein Großvater verschwand im Gulag. Der Vater musste als Kind eines Verfolgten seine Herkunft verleugnen. Schischkin erinnert sich: „Sein ganzes Leben lang lebte er mit der Angst, dass man ihn jeden Moment entlarven und verhaften könnte. Diese Angst durchdringt, ob man es will oder nicht, von Generation zu Generation jedes Wort, das in kyrillischer Schrift geschrieben ist.“
Wie jäh die alten Wunden wieder aufbrechen können, hat Schischkin in Telefongesprächen mit seiner hochbetagten Großmutter erfahren: „Ich sage: Grüß dich, Oma, ich bin’s, Mischa. Sie unterhält sich mit mir, und an einem bestimmten Punkt setzt die Verwirrung ein. Sie begreift: Mischa, das ist ihr Mann, den sie damals verhaftet haben. Sie ist wieder in der Situation der Verhaftung, fängt plötzlich an zu schreien: Lasst ihn los, wo bringt ihr ihn hin? Alles Vergangene ist hier, gegenwärtig.“ Gewiss: Bisweilen scheint sich in Venushaar die Polyphonie vergangener und gegenwärtiger Schicksale in postmoderne Beliebigkeit aufzulösen. Zeit und Raum sind porös. Durch die Löcher schlüpfen sogar die alten Griechen ins Jetzt. Da mutieren dann Daphnis und Chloe von Hirten zu modernen Zoobesuchern.
Ist also alles nur eine Neuauflage längst erzählter Geschichten, eine weitere Runde im endlosen Ringelreihen der Texte, das der Roman auf die verspielte Formel bringt: „Wenn Griechen hinter Griechen kriechen, kriechen Griechen Griechen nach…“? Keineswegs. Eine ehemalige Lehrerin des Dolmetsch hält gegen die Nivellierung aller Grenzen im unendlichen Text: „Die alten Griechen sind das eine, die Tschetschenen das andere.“ Ausgerechnet in Rom, wo die Vergangenheit allgegenwärtig ist, plädiert sie dafür, jede Geschichte, jede Stimme in ihrer Unverwechselbarkeit wahrzunehmen.
Eine solche Einzelstimme kommt im zweiten Erzählstrang zu Wort, den (fiktiven) Aufzeichnungen der Romanzensängerin Isabella Jurjewa, die es tatsächlich gegeben hat. Was ist denn daran interessant? fragt die junge Frau, als ihr jemand die Anabasis empfiehlt. Konsequent strebt sie nach einem Leben ohne den Wiederholungszwang des Leidens. Jedes Unrecht, ob historisch oder gegenwärtig, hält sie sich mit der Devise vom Leib: „Je ärger das Unglück der einen, desto entschiedener müssen die anderen auf ihrem Glück bestehen. Desto stärker müssen sie lieben. Damit die Welt im Gleichgewicht bleibt.“
Die Kritik hat diesen vermeintlichen Schlüsselsatz des Romans aufgegriffen und sich an ihm gerieben. Dabei wird er im Roman selbst ausdrücklich in Zweifel gezogen. Auch der Autor stellt im Gespräch klar, dass man es sich so einfach nicht machen darf: „So hätte man es gern. Aber das funktioniert nicht. Natürlich kann man des Lebens nicht froh werden, wenn man im Paradies wohnt und sich unter einem die Hölle auftut.“
Michail Schischkin: Venushaar. Roman. Aus dem Russischen von Andreas Tretner. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 560 Seiten, 24,99 €. – Am heutigen Mittwochabend um 20 Uhr findet im Haus der Kulturen der Welt, moderiert von Luzia Braun, die Preisverleihung mit einer Festrede von Hanns Zischler statt. Eintritt frei.
Kopf gegen Hand
Internationaler Literaturpreis für den Roman Venushaar: Ein Gespräch mit dem in Russland berühmten Autor Michail Schischkin und seinem Übersetzer Andreas Tretner
Von Ekkehard Knörer
Herr Schischkin, Sie befinden sich in einer eigentümlichen Situation. Sie sind ein in Russland viel gelesener, gefeierter und mit den bedeutendsten Preisen ausgezeichneter Autor. Aber Sie leben seit 1995 recht unberühmt in der Schweiz, erst jetzt wurde mit dem Venushaar Ihr Name auch hier bekannt.
Michail Schischkin: Etwas merkwürdig war das schon. Ich schreibe auf Russisch, und natürlich bin ich glücklich über meine russischen Leser, die Wertschätzung meiner Bücher in Russland. Aber: Das Deutsche ist die Sprache in meinem Lebensraum. Meine Romane sind in viele Sprachen übersetzt – aber ausgerechnet in meinem Lebensraum gab es nichts. Deshalb freue ich mich sehr, dass DVA endlich eine Übersetzung gewagt hat. Zuvor gab es viele, viele Absagen von deutschen Verlagen: Fast immer mit dem Argument, meine Bücher seien zu anspruchsvoll und deshalb zu riskant. Da musste ich mich schon fragen: Für wie dumm halten diese Verlage denn ihre Leser?
Und in die andere Richtung gefragt: Wie sehen Sie Ihr Verhältnis zur russischen Literatur?
Schischkin: Leider ist die russische Literatur im Lauf des 20. Jahrhunderts ins Abseits geraten. Wenn man die Menschen in eine Art Käfig steckt, dann grenzen sie sich ab, dann entsteht eine Art Subkultur, eine eigene Sprache mit eigenen Witzen, dann interessieren sie sich nicht mehr dafür, was draußen passiert. Die Orientierung nach außen wurde jahrzehntelang unterbunden. Die russische Literatur hat über Jahrzehnte die ganze erzähltechnische Entwicklung der Morderne und der Weltliteratur verpasst. Das musste sie erst einmal aufarbeiten, nachholen, bevor sie wieder zu einer eigenständigen Entwicklung finden konnte. Nun aber ist es an der Zeit, selbst einen Schritt nach vorne zu tun. Und schon deshalb denke ich: Ja, ein Autor muss auch einmal im Ausland leben. Wer das nie tut, lebt in einem Haus ohne Spiegel. Und man braucht Spiegel, um sich selbst zu verstehen.
Andreas Tretner: Übrigens ist es sehr viel schwieriger, Texte aus einem solchen Käfig ohne Spiegel zu übersetzen. Man muss dem Leser da oft umständlich Sachen erklären, noch dazu in Worten, die gar nicht wirklich angemessen sein können. Eine weltoffene Literatur, eine Literatur, die auf diese Weise den abgeschlossenen eigenen Raum überschreitet, ist viel besser übersetzbar. Und Venushaar ist für mich ein exemplarischer Fall einer solch offenen Literatur.
Schischkin: Ich saß da also in Zürich, in meiner kleinen Wohnung gegenüber vom Krematorium Nordheim, und schrieb meine russischen Texte. Dabei hatte ich aber immer ganz kompromisslos meinen „idealen Leser“ in Russland vor mir.
Wie sieht der aus?
Schischkin: Nun, der steht neben mir und es gefällt ihm alles, was mir gefällt. Und er hasst alles, was ich hasse. Das Risiko hinterher ist dann, dass du allein bleibst mit deinem idealen Leser. Ich hatte das Glück, dass ich dann doch viele Leser in Russland, meiner Heimat, gefunden habe. Auch die Preise sind schön, die Theaterinszenierungen ebenso. Aber viel wichtiger waren für mich die Treffen mit meinen wirklichen Lesern in der Provinz. Vor einem Jahr habe ich eine Lesereise durch die Kleinstädte im Wologda-Gebiet gemacht, ein richtiges russisches Krähwinkel. Da kam die russische Provinzintelligenz zusammen: die Lehrer, die Apotheker, die Bibliothekarinnen. Und sie hatten meine Bücher dabei und erklärten, wie wichtig sie ihnen sind. Das hat mich sehr berührt. Die Rolle und Bedeutung der Literatur in Russland ist mit kaum einem anderen Land zu vergleichen. Lesen ist dort Kampf um die Selbsterhaltung, um die Bewahrung der menschlichen Würde angesichts einer erniedrigenden politischen Realität.
Können Sie sich Ihre deutschen Leser vorstellen?
Schischkin: Es ist schwierig. Ich hoffe natürlich, dass es auch hier Leser geben wird, denen mein Buch etwas gibt. Wobei es dann nicht meine Worte, sondern die von Andreas sind, denen diese Wirkung zu verdanken ist. Aber es ist doch etwas anderes in Russland. Es gibt ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde: Ich saß in einem Café in Moskau, damals war gerade mein Roman Die Eroberung von Izmail erschienen. Sie kam zu mir und sagte: „Sie sind ja Michail Schischkin, der Schriftsteller? Sie haben für mich die russische Literatur gerettet“. Ich glaube, hier wäre so etwas unvorstellbar.
Herr Tretner, haben Sie das Gefühl gehabt, dass Schischkins Romane unübersetzbar sind?
Tretner: Es war in der Tat das erste Mal, dass ich mich in dieser Situation befand. Ich kann mir schon vorstellen, dass einen das als Übersetzer blockiert. Die Nervosität war anfangs tatsächlich größer als sonst, aber wir haben sehr schnell eine Grundlage gefunden. Wir kannten uns schon, ich kannte seine „Stimme“, was ich sehr wichtig finde. Im Grunde war es dann nicht völlig anders als sonst. Was hinzukam, war die Tatsache, dass der Autor der Vorlage zugleich mein erster Lektor war. Wir konnten besonders schwierige, heikle Dinge immer diskutieren. Aber reingeredet hat er mir nicht. Insgesamt war das zwar etwas aufwendiger als sonst, aber sehr angenehm. Ich glaube im Übrigen, dass es für Michail die schwierigere Situation war. Schließlich musste er mit dem leben, was ich aus seinen Worten, seinem Buch machte.
Schischkin: Ich würde die Situation mit dem Theater vergleichen – ein Übersetzer muss sich wie ein Regisseur absolut frei fühlen. Die Übersetzung ist die Inszenierung, die Interpretation. Ich habe meine Funktion nur darin gesehen, Dinge zu erklären, die ich mit meinem russischen Hintergrund erklären kann. Aber sehr bald war er dann allein gegen den Text, allein gegen die deutsche Sprache.
Tretner: Ich denke, dass ich als Übersetzer so etwas wie der vorhin beschriebene ideale Leser sein muss, mich ihm jedenfalls so weit wie möglich annähern sollte. Venushaar ist nun ohnehin ein besonderer Fall: Schon auf der reinen Handlungsebene findet man ja als eine der Hauptfiguren den Dolmetscher – also quasi einen Kollegen. Das gilt aber erst recht auf einer viel grundsätzlicheren Ebene. Im Grunde handelt das Buch von der Wiederauferstehung oder der Wiederherstellung der Welt durch Sprache. Nichts anderes ist das Übersetzen. Vieles, was in diesem Buch explizit verhandelt wird, ist ganz nah dran an dieser Unmöglichkeit, mit der man es beim Übersetzen zu tun hat. Man muss vieles erst einmal einreißen, um es dann als Abbild des Originals wieder erstehen zu lassen.
Schischkin: Genau das ist aber auch die Aufgabe des Schriftstellers selbst. Ich denke dabei an ein Schlüsselerlebnis, das ich als Jugendlicher hatte. Ich war das erste Mal verliebt und wollte das der betreffenden Person bekennen. Dabei setzte ich zum Sprechen an – und stellte fest: Ich habe eigentlich keine Worte dafür. Was könnte ich sagen, um wirklich auszudrücken, wie ich empfand? Das gilt, denke ich, grundsätzlich: Die Worte, die Sätze, die wir haben, sind längst tot – abgenutzt, verbraucht, tausendmal gesagt. Und doch ist die Aufgabe des Schriftstellers genau diese: die Worte wieder auferstehen zu lassen. Durch die toten Wörter etwas Lebendiges zu sagen. Und das kann nur gelingen, indem man nicht nur die Worte benutzt, sondern auch den Raum um die Worte herum.
Wiederauferstehen ist ein gutes Stichwort. Das Motto von Venushaar stammt aus dem apokryphischen Buch des Baruch, aber eben diese Worte fehlen im Original: „Denn durch das Wort ward die Welt erschaffen, und durch das Wort werden wir einst auferstehen.“
Schischkin: Sieh an. Das ist bisher vor allem den Übersetzern aufgefallen. Ich muss es freilich zugeben, den Satz habe ich Baruch in den Mund geschoben. Ich wollte diesen Satz in meinem Motto haben. Ich habe gesucht und gesucht und war sicher, es gibt so etwas in der Bibel. Ich wurde aber nicht fündig – was blieb mir da übrig?
Venushaar ist ein Buch, das reich ist an Stimmen, Materialien, Verweisen, Bezügen, es ist auf Augenhöhe mit der Weltliteratur von Xenophon bis Gogol, von russischen Volksmärchen bis zu Poe. Was für den Übersetzer wiederum eine große Herausforderung ist – ein ständiger Wechsel der Tonlagen, der Stimmen, ein An- und Abschwellen eines gewaltigen Chors. Herr Tretner, wie erging es Ihnen damit?
Tretner: Ja, in den Teilen, die Sie ansprechen – es gibt ja auch andere, vor allem die Aufzeichnungen der Sängerin Isabella Jurjewa –, wechseln und wandeln sich Stimmen rapide, manchmal beinahe wie ein „Morphing“, sodass ich immer wieder nachjustieren, nachfokussieren musste. Am schwierigsten war das dann in dem Crescendo am Ende, in dem sich die Figuren und Stimmen komplex und bis beinahe zur Ununterscheidbarkeit überlagern. In solchen Passagen finde ich das Buch wirklich in musikalischen Metaphern fassbar: Es geht um Tonlagen, um die Exposition von Themen und den Wechsel von Tonarten. Das macht übrigens auch klar, dass bestimmte Fragen an das Buch nicht leicht zu beantworten sind: Wovon handelt eine Sinfonie von Penderecki? Was haben wir da erfahren? Ähnlich kann es einem auch mit Venushaar ergehen.
Schischkin: Für mich ist das Buch sehr einfach gebaut. Eine sehr klare Konstruktion. Am Anfang gibt es verschiedene Stimmen, Wirklichkeiten, Realitäten, die einander entgegengesetzt sind: Wie kann man weiter voneinander entfernt sein als ein Asylsuchender und die Person, die ihm den Zugang verweigert? Es bewegt sich in Richtung einer gegenseitigen Verständigung. Diese Stimmen, Bewusstseinsebenen kommen zueinander, verflechten sich. So einfach ist das.
Tretner: So einfach ist das aber bei Weitem nicht. Jedenfalls sobald man näher rangeht. Es bleiben Abstoßungen, Wirbel, Gegensätze trotz dieser klaren Grundrichtung.
Da muss ich die Frage an den Autor gleich anschließen: Wie entsteht das, dieser Chor, diese Verwirbelungen einzelner Stränge, dieses An- und Abschwellen von Stimmen? Wie fängt es an, wie komponiert sich das?
Schischkin: Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. Es ist immer der Kampf zwischen meinem Kopf und meiner Hand. Ich denke mir etwas aus, ich plane eine Handlung, es gefällt mir alles gut – aber die Hand will das nicht machen. Sie hört nicht auf mich. Dann muss ich aufgeben und warten, bis die Hand selber schreibt. Es gibt da einen Diener und einen Herrn. Der Herr ist der Roman, ich bin sein Diener. Darum kann ich die Fragen: Warum schreiben Sie das, warum so und nicht anders, nie beantworten. Ich schreibe einfach und kann dann sagen: Ja, es ist gut.
Aber es gibt doch sicher auch den Schlag auf die Schreibhand und die Ermahnung: Das war jetzt nix.
Schischkin: Natürlich, immer. Darum schreibe ich ja auch nicht jährlich einen Roman, sondern brauche jedes Mal wieder fünf Jahre. Ich beschleunige nie, ich kann es nicht erzwingen. Ich muss einfach warten, bis er fertig ist. Wann das ist, weiß ich aber nie vorher. Ich setze nicht den Schlusspunkt. Nur der Roman weiß das. Er setzt den Punkt.
Zu Autor und Übersetzer
Mikhail Shishkin, 1961 geboren, ist in Russland als einer der bedeutendsten Autoren der Gegenwart anerkannt und hat die wichtigsten literarischen Auszeichnungen erhalten. “Venushaar” ist die erste Übersetzung eines seiner Romane ins Deutsche. Shishkin hat aus privaten Gründen 1995 verlassen, zog nach Zürich und hat als Dolmetscher für die Schweizer Einwanderungsbehörde gearbeitet. Seit dem letzten Jahr hat er wieder eine Wohnung in Moskau und pendelt zwischen der Schweiz und Russland.
Andreas Tretner, 1959 geboren, arbeitet seit 1985 als literarischer Übersetzer aus dem Russischen, Tschechischen und Bulgarischen. Er ist die deutsche Stimme von Autoren wie Viktor Pelewin, Vladimir Sorokin und Boris Akunin. 2001 wurde er mit dem Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet.
Zum Buch
Alles beginnt in Kreuzlingen, an der Schweizer Grenze. Ein Asylantragsteller und der zuständige Beamte sitzen sich gegenüber. Schnell aber weitet sich der Dialog zu einem Chor der mal für sich, mal durcheinander sprechenden Stimmen. Es überlagern sich der Tschetschenien- und der in Xenophons Anabasis geschilderte persische Krieg. Ein Dolmetscher reist nach Rom und muss erfahren, dass er für seine Frau nur die schlechte Kopie ihres verstorbenen ersten Manns ist. In Tagebuchnotizen der (real existierenden) Sängerin Isabella Jurjewa wird dazwischen das russische 20.Jahrhundert aufgeblättert. Gewaltig sind die Echoräume der Weltliteratur, in die Michail Schischkin hineinruft und von Poe bis Gogol rufen alle zurück. Ein wahres Wunderwerk ist Andreas Tretners Übersetzung, die den gewaltigen Strom aus Stimmen und Tönen noch einmal erschafft.
Gemeinsam erhalten Michail Schischkin und Andreas Tretner am 29. Juni den Internationalen Literaturpreis Haus der Kulturen der Welt. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert und geht anteilig an Autor (25.000 Euro) und Übersetzer (10.000 Euro).
Brandwunden aus der Einwanderungsbehörde
Ehrung: Michail Schischkin erhält für seinen Roman Venushaar den Internationalen Literaturpreis 2011.
Von Eva Pfister
“Stuttgarter Zeitung”, 17.06.2011
Sein erstes ins Deutsche übersetzte Werk hat die Jury auf Anhieb überzeugt: Michail Schischkin erhält den Internationalen Literaturpreis 2011, den das Berliner Haus der Kulturen der Welt zum dritten Mal verleiht. Sein Roman Venushaar, so die Begründung, „besticht durch Experimentierfreude und stilistische Vielfalt. Er schlägt mit großer sprachlicher Kraft die Brücke von der Revolutionsepoche in die Gegenwart, einschließlich des russisch-tschetschenischen Konflikts und der Asylsuchenden in der Schweiz“.
Der russische Autor lebt seit 1995 in der Schweiz und hat zehn Jahre lang als Dolmetscher für die Einwanderungsbehörde gearbeitet. Diese Arbeit habe bei ihm „Brandwunden“ hinterlassen, sagte er in einem Interview. In Venushaar beschreibt er das amtliche Frage-Antwort-Spiel und deutet einige der grausamen Geschichten an, die von den Asylsuchenden erzählt – und von den Beamten meistens nicht geglaubt werden. Aber diese Geschichten verfolgen den „Dolmetsch“, wie Schischkin sein Alter Ego im Roman nennt. Denn sie seien „echt“, unabhängig davon, ob sie nun genau der Person passiert seien, die sie erzählte.
So gerät Schischkin von der politischen in die ästhetische Dimension und macht das Geschichtenerzählen zum Thema seines breit angelegten Buches. Von der Gegenwart springt er in Fluchtschilderungen aus der Bibel, in Kriegsberichte der Antike und aus orientalischen Mythen. Von seiner Heimat Russland erzählt er, von der strengen Lehrerin Galpetra und von den Kriegen in Afghanistan und Tschetschenien. Zwischen diese drastischen und erschütternden Schilderungen ist das Tagebuch einer russischen Sängerin eingestreut, die traumwandlerisch durch die Zeiten taumelt, und – ob Revolution oder Krieg – meist nur an ihre Auftritte und ihre Liebhaber denkt. Als dritter Handlungsstrang findet sich die traurige Liebe des Dolmetschs zu einer Frau, die er Isolde nennt, da ihre Liebe einem verstorbenen Tristan gilt. Er selbst, ihr lebendiger Begleiter in den Museen Roms, fühlt sich plötzlich wie eine der Statuen, die doch bloß Kopien verschollener griechischer Originale sind.
Der Schriftsteller Michail Schischkin ist nicht als Flüchtling, sondern aus privaten Gründen in die Schweiz emigriert. Davor war er in Moskau als Lehrer für Deutsch und Englisch tätig. Während der russisch schreibende Autor im deutschsprachigen Literaturbetrieb bis jetzt noch ein Unbekannter ist, hat er für seinen ersten Roman Die Eroberung von Ismail den russischen Booker-Preis erhalten, seine Texte werden mit Dostojewski oder Nabokov auf eine Stufe gestellt. Ein Theaterstück auf der Basis von Venushaar wird in Moskau seit vier Jahren en suite gespielt.
Dank der Anmerkungen des ebenfalls durch den Preis geehrten Übersetzers Andreas Tretner erfahren auch slawistisch nicht vorgebildete Leser, aus welch reichem Fundus sich Schischkin bedient, wie sehr es in dem Text wimmelt von Anspielungen, Zitaten und skurrilen Details. Wie das „Venushaar“, ein Farngewächs, durch alte Mauern sprießt und Ruinen überwuchert, so lässt Michail Schischkin die Erzählungen der Menschheit durch die Zeiten wachsen. Sein Anspruch ist monumental, die vielen Arabesken führen bei der Lektüre manchmal in die Irre, aber die Kraft seines Erzählens trägt bis zum Ende.
«Die Quote stimmt immer»
Michail Schischkin: Venushaar
Von Eva Pfister
WOZ, 16.06.2011
Kurz vor Redaktionsschluss hat Michail Schischkin für Venushaar den Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt erhalten. Der Roman, in dessen Zentrum Schicksale von Asylsuchenden stehen, fusst auch auf den Erfahrungen des russisch-schweizerischen Autors in der Schweiz.
Seit 1995 lebt Michail Schischkin – ein in Russland gefeierter Autor, dessen Werke in vierzehn Sprachen übersetzt sind – in der Schweiz. Zehn Jahre lang arbeitete er hier als Dolmetscher für die Einwanderungsbehörde. Diese Arbeit habe bei ihm Brandwunden hinterlassen, äusserte er vor einiger Zeit. «Brandwunden?» Die Nachfrage erreicht den Autor in Moskau und löst Emotionen aus: «Was würden Sie empfinden, wenn Sie täglich im Büro haarsträubende Geschichten übersetzen müssten? Wenn eine Mutter ihr Kind mit abgeschnittenen Fingern als Beweis der Verfolgung vorweist? Ist das etwa nicht herzzerreissend? Im normalen Leben kann man solcher Realität ausweichen, zum Beispiel auf einen anderen Sender umschalten. Aber bei der Befragung eines Gesuchstellers muss man als Dolmetscher alles in sich hineinnehmen. Du kannst das nicht ‹löschen› wie eine alte Datei. Das alles wird zu einem Teil von dir. Und das kann wehtun.»
Diese «Brandwunden» sind der Ausgangspunkt von Michail Schischkins aktuellem Roman Venushaar, für den er in seiner russischen Heimat gleich zwei Preise erhielt und in englischen Zeitungen auf eine Stufe mit Dostojewski und Nabokov gestellt wurde. Das gewaltige Opus setzt mit dem Frage-Antwort-Spiel in einem Empfangszentrum ein, wie es sich zwischen den Beamten und den mit «GS» abgestempelten Gesuchstellern abspielt. Es deutet einige der grausamen Geschichten an, die von den GS erzählt und von den Beamten angezweifelt werden. Dann aber verlagert sich das Geschehen, die Fluchtgeschichten stammen plötzlich aus der Antike oder aus osteuropäischen Mythen. Sie mischen sich mit drastischen und erschütternden Schilderungen aus dem sowjetisch-afghanischen Krieg und dem Tschetschenienkrieg – nicht nur aus der Perspektive der Opfer, sondern auch aus dem brutalen Alltag der Soldaten.
Diese Erfahrungen blieben dem 1961 geborenen Autor erspart, «weil ich als junger Mann das Glück hatte, dass wir an der Pädagogischen Hochschule in Moskau, wo ich Germanistik und Anglistik studierte, eine Ausbildung als Militär-Dolmetscher machen konnten. Das hat mich vor dem Militärdienst und damit vor Afghanistan gerettet.» Aber Schischkin hatte Freunde, die ihm von ihrer Zeit im Militär erzählten. Ihre Geschichten fliessen ebenso in Venushaar ein wie die der Asylsuchenden in der Schweiz. Für den «Dolmetsch», wie Schischkin sein Alter Ego im Roman nennt, sind diese Geschichten «echt», unabhängig davon, ob sie nun genau der Person passiert sind, die sie erzählt.
Die Wahrheit der Geschichten liegt in ihrer Glaubwürdigkeit. Diese entscheidet auch über das Schicksal der Asylsuchenden, wie der Beamte Peter – auch Petrus, der Paradiesverteidiger genannt – zugibt. Seine Aufgabe ist es, möglichst viele der «GS» abzuweisen. Schischkin hat während seiner Zeit als Dolmetscher begriffen, dass in Wirklichkeit die Quote entscheidet: «Nicht die wahren oder unwahren Schicksale, sondern die statistische Quote: Soundso viele Gesuche werden jährlich bewilligt. Bei jedem Gesuch kann man irgendwelche Ungereimtheiten finden, das genügt für den negativen Entscheid. Die erzählten Geschichten können stimmen oder nicht, aber die Quote stimmt immer.»
Die Glaubwürdigkeit einer Geschichte ist aber auch ein literarisches Kriterium, und darum ist das Erzählen selbst ein wichtiges Thema des breit angelegten Romans. Dank der Anmerkungen des Übersetzers Andreas Tretner erfahren auch slawistisch nicht vorgebildete LeserInnen, aus welch reichem Fundus sich der Autor bediente, und wie sehr es im Text von Anspielungen, Zitaten und skurrilen Details wimmelt. Wie das «Venushaar», ein Farngewächs, das durch alte Mauern spriesst und Ruinen überwuchert, so lässt auch Schischkin die Erzählungen von Gewalt und Flucht durch Orte und Zeiten wachsen. Dazwischen ist das Tagebuch einer russischen Sängerin eingestreut, die traumwandlerisch durch das Jahrhundert taumelt und – ob Revolution oder Krieg – meist nur an ihre Auftritte und Liebhaber denkt.
Als weiterer Handlungsstrang wird die traurige Liebe des «Dolmetsch» zu einer Frau erzählt, die er Isolde nennt, da ihre Liebe einem verstorbenen Tristan gilt. Er selbst, ihr lebendiger Begleiter in den Museen Roms, fühlt sich plötzlich wie eine der Statuen, die bloss Kopien verschollener griechischen Originale sind. Eine bittere Liebesgeschichte, deren Ende absehbar ist: Bei einem Abendessen spaltet sich die Tischrunde. Die einen – mit ihnen Isolde – verschwinden auf die Terrasse, während die anderen die Gräuelvideos aus Tschetschenien sehen wollen, die dem «Dolmetsch» zugespielt wurden. Dass er mit Folterszenen den gemütlichen Abend zerstört, verzeiht ihm Isolde nicht.
Michail Schischkin ist nicht als Flüchtling, sondern wegen einer Liebe in die Schweiz gezogen. Erlebte er hier das Gespaltensein einer Person, die in zwei Wirklichkeiten zugleich lebt: in der friedlichen der Schweiz sowie in einer anderen, kriegsgebeutelten Welt? So einfach sieht der Autor das nicht: «Wir alle leben zugleich in mehreren Wirklichkeiten. Vier Schweizer nehmen sich täglich das Leben in ihrer ‹friedlichen› Wirklichkeit. Das ist die Statistik. Sowohl Russland mit seinen schrecklichen Geschichten, als auch die friedliche Schweiz gehören zu den fünf Ländern mit der höchsten Suizidrate. In diesem kalten Kosmos können wir nur überleben, weil die Menschen diese Erde mit ihrer Menschlichkeit umhüllen und erwärmen. Darüber wollte ich in meinem Venushaar schreiben.»
Der neue Tolstoi lebt in Zürich
Der Roman Venushaar hat dem Russlandschweizer Michail Schischkin zahlreiche Preise eingebracht. Jetzt liegt dieses faszinierende Gemälde menschlicher Schicksale auch auf Deutsch vor.
Von Guido Kalberer
“Tagesanzeiger”, 11.06.2011
Wenn Michail Schischkin in der russischen Provinz vorliest, zweifelt er keinen Moment daran, dass Literatur das Leben verändern kann. In den abgelegenen Gebieten, wo die Zeit zwischen Mittelalter und Moderne festgefroren ist, sei das Dasein so erniedrigend, dass Bücher als einziger Lichtblick erscheinen: «Während Lesungen hierzulande Events unter anderen sind, geben sie dort den Individuen ihre Würde zurück.» Er sagt das in ruhigem Ton und einer analytischen Klarheit, die seinen Aussagen eigen ist. «Gegen die Grausamkeit der Welt hilft nur die menschliche Wärme», sagt er, und Literatur habe auch die Aufgabe, die Brutalität und Gewalttätigkeit zu bekämpfen. Vor Pathos schreckt der 50-jährige Schriftsteller nicht zurück, im Gegenteil: «Jeder kann ironisch über die Liebe schreiben, pathetisch aber nicht», sagt der Autor bei unserem Gespräch im Café Neumarkt in Zürich.
In seinem Heimatland wird Michail Schischkin hoch gehandelt. Er hat alle bedeutenden Literaturpreise erhalten (den russischen Booker-Preis, den nationalen Buch-Preis usw.) und wird von den Kritikern mit den ganz Grossen der russischen Literaturgeschichte verglichen: mit Tolstoi, Michail Bulgakow und Vladimir Nabokov. Leidet er unter diesem Erwartungsdruck? Die Antwort kommt genauso schnell wie bestimmt: «Nein, ich freue mich!»
Insbesondere über den Vergleich mit Tolstoi, der ihn vor allem eines lehrte: keine Scheu vor Naivität zu haben. Nur so können die einfachen, die grossen Fragen gestellt werden, die die Menschen beschäftigen: Was ist die Liebe? Wie verhalten wir uns zum Tod? «Als ich sieben Jahre alt war und auf der Datscha meiner Grossmutter den Sommer verbrachte, sah ich eines Tages eine tote Katze am Strassenrand liegen. Dieses Erlebnis wühlte mich auf: Passiert das auch meiner Grossmutter und allen anderen Menschen, die ich liebe?» Bis zu der Einsicht, dass der Tod die höchste Gabe des Lebens ist, sei es ein weiter Weg gewesen.
Auch in Venushaar, dem ersten auf Deutsch vorliegenden Roman Mischkins, geht es um die Überwindung des Todes durch die Liebe und die Kunst. Auf 550 Seiten breitet der Autor ein hochkomplexes, dichtes Geflecht aus, das Erzählebenen und Geschichten miteinander verwebt: Erzählungen von Asylbewerbern aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, die der «Dolmetsch», in dem der Leser den Autor vermutet, für die Schweizer Behörden übersetzen muss und die so drastisch sind, dass Wahrheit und Dichtung nicht mehr zu unterscheiden sind. Es geht aber auch um eine gescheiterte Liebe zwischen Tristan und Isolde und um das fiktive Tagebuch einer russischen Sängerin, die ihr Leben der Bühne verschrieben hat.
Der faszinierende Roman verlangt dem Leser einiges an Konzentration ab: Die Wechsel der Ebenen sind subtil, und die Geschichten erreichen ein episches Ausmass, das wir von unseren helvetischen Kurzschreibern nicht kennen. Das Buch ist wie eine weite Ebene in Sibirien, auf der sich die verschlungenen Lebenswege in alle Richtungen verlaufen, bis sie, so Schischkin, in der Ewigen Stadt Rom zusammenfinden. «Am Schluss werden alle Figuren eine Person, und die vielen Stimmen finden zu einer allgemeinen Harmonie zusammen.» Wollte man Venushaar mit einem Film vergleichen, so am ehesten mit The Tree of Life von Terrence Malick. Selbst in den kleinsten Geschichten geht es in Venushaar ums grosse Ganze: Wer sich der Endlichkeit bewusst ist, kann nicht anders, als an die Unendlichkeit zu denken – dieses hohe Pathos erfordert eine hohe Kunst.
Je länger wir uns unterhalten, desto klarer wird: Hier spricht einer, der unbedingt, das heisst ohne Bedingungen, Autor ist und sein will. Dies belegt auch seine Replik auf die Frage, ob er vom Schreiben leben könne. «Nein, davon kann ich nicht leben, aber ich lebe.» Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, unser Gespräch kehrt zur Literatur zurück: «Manche Schriftsteller sehen sich als Herren ihrer Romane. Ich selbst fühle mich eher als ihr Diener. Erst wenn eine Geschichte mich an den Schreibtisch ruft, entsteht ein Roman.» Manchmal geht das schnell, manchmal dauert es Wochen und Monate, bis sich die Kreativität bei ihm meldet.
Beim Schreibprozess geht es Schischkin weniger um einzelne Worte, sondern um den Raum, den sie erschliessen und in dem sie ihre Bedeutung entfalten. So bleiben die Metaphern und Bilder aus Venushaar auch nach der Lektüre im Gedächtnis haften: Wörter, die jemand «wie Nüsse knackt», der eisige Atem, den man «wie Zuckerwatte am Stiel» vor sich herträgt, eine Bar, «wo der fauchende Kaffeeautomat wie in einer Höhle wohnt».
Seit 15 Jahren lebt der gebürtige Moskauer in Zürich. Dem hiesigen Publikum ist er, wenn überhaupt, als Autor von Sachbüchern etwa über Die russische Schweiz aufgefallen. Dabei liegen bereits vier Romane von ihm vor, einige davon sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Mit Venushaar, 2005 im Original erschienen und schon seit vier Jahren als Bühnenfassung in Moskau zu sehen, kommt das deutschsprachige Publikum relativ spät in den Genuss der schischkinschen Poesie. Sein neuester Roman mit dem Titel Pismovnik, der nächstes Jahr auf Deutsch erscheint, wird zurzeit ebenfalls dramatisiert. Die Premiere findet im Oktober auf der Bühne des renommierten Tschechow-Künstlertheater in Moskau statt – ein Beleg für die nachhaltige Popularität dieses Autors in seiner Heimat.
Doch was heisst schon Heimat für jemanden, der zwischen den Ländern pendelt? Das Ausland ist für ihn wie ein Spiegel: Er erkenne sich darin und sei doch immer wieder erstaunt über sich selbst – diese Selbstbeobachtung ist für Schischkin ebenso bedeutsam wie das Leben in verschiedenen Ländern. Doch Heimat sei für ihn letztlich die russische Sprache, und die habe er stets dabei auf seinen Reisen: «Ich nehme Sätze in den Mund und teste sie. Korrekt schreiben kann ich, das will ich nicht. Wie aber dann schreiben?» Er nippt am Wasserglas und schaut mich lange an, dann antwortet er selbst: «Es geht darum, im Schreiben eine Realität zu erschaffen, die Bestand hat. Die Worte können den Tod überwinden, so wie die Werke Tolstoi überlebt haben.»
Die Kraft des Wortes
von Olga Hochweis
Deutschlandfunk Kultur, 11.05.2011
Sie erzählen von ihrer Vergewaltigung im Kinderheim oder von der Ermordung der eigenen Mutter: Mit entsetzlichen Berichten von Leid und Verfolgung versuchen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion Asyl in der Schweiz zu ergattern. Die teils erfundenen, teils wahren Geschichten der „GS“ (Gesuch-Steller) überprüft der Beamte Peter Fischer, ein unerbittlicher Petrus am Eingang zum Paradies. Assistiert wird Fischer vom „Dolmetsch“, der zentralen Figur des Romans und dem Alter ego des Autors. Er ist ein Russe, der in der Schweiz lebt und sein Geld als Übersetzer in der Einwanderungsbehörde verdient. Die Arbeit hinterlässt seelische Wunden und relativiert das Bild vom Paradies: Selbst im goldenen Westen ist es unerreichbar.
Venushaar, der Roman von Michail Schischkin, erzählt von Konflikten und Kriegen an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Lebensgeschichten, Epochen und Orte, Traum und Realität, Erzählrhythmen, Perspektiven, Sprach- und Stilebenen ergeben ein dichtes Geflecht, ähnlich einem Frauenhaarfarn namens „Venushaar“. Es überwuchert Mauern und Zeiten.
Der namenlose Dolmetsch liest in den Kaffeepausen zwischen den Befragungen seiner Landsleute in der Anabasis von Xenophon, der erzählt, wie er im 4. Jahrhundert vor Christus nach dem Tod des Kyros und der blutigen Schlacht 10.000 griechische Männer in die Heimat führt. Fiktive Tagebuch-Aufzeichnungen und Briefe von Bella Jurjewa (1899-2000), einer russischen Romanzen-Sängerin, schildern den Ersten Weltkrieg und die Bürgerkriegsjahre in der Sowjetunion.
Der Dolmetsch hatte vor seiner Emigration Jurjewas Aufzeichnungen kopiert, um eine Biographie zu verfassen. Das gescheiterte Buchprojekt ist eine von vielen Episoden seiner Vergangenheit, die mit Schulzeit, Jugend und einem in der Heimat zurückgelassenen Sohn die dritte Ebene des Romans bilden. Auch in der Schweiz gibt es ein Kind aus der gescheiterten Beziehung zu Isolde, einer Schweizer Slavistin.
Zwischen diesen drei Erzählebenen finden sich, immer ausufernder erzählt, die Geschichten der Gesuch-Steller. Ihre Schicksale sind glaubwürdig bis ins letzte Detail. Sie machen die Frage nach wahr oder falsch hinfällig: „Die Leute sind vielleicht nicht echt, aber die Geschichten sind es! Wenn sie im Kinderheim nicht den mit den aufgeworfenen Lippen vergewaltigt haben, dann einen anderen!“ Es ist die Kraft des Wortes, der Literatur, die Michail Schischkin in seinem Buch beschwört. Ihm vorangestellt hat er ein Zitat aus dem Alten Testament: „Denn durch das Wort ward die Welt erschaffen, und durch das Wort werden wir einst auferstehen.“
Venushaar ist ein so kunstvolles wie komplexes Meisterwerk. Andreas Tretner hat es makellos ins Deutsche übertragen.
Die Göttin der Liebe im Exil
Grandioser Erzählteppich aus tausendundeiner Geschichte: Michail Schischkins Roman Venushaar
Von Ralph Dutli
“NZZ am Sonntag”, 24.04.2011
Zahlreiche Asylsuchende wollen Zugang zum heissbegehrten Schweizer Paradies, das glänzt vor Wohlstand und Verschontheit. Sie werden bürokratisch kalt als „GS“ (Gesuchsteller) etikettiert. Der Hauptakteur in Michail Schischkins Roman Venushaar ist Russischdolmetscher in Diensten der Asylbehörde und bekommt schauerliche Erzählungen zu hören, denn nur die haarsträubendsten Ungeheuerlichkeiten haben Aussicht auf Erfolg. Am Paradiesestor nämlich wacht argwöhnisch Peter alias Petrus, dem der Stempel der beschleunigten Abweisung bedrohlich locker in der Hand liegt. Für ihn hat der namenlose „Dolmetsch“, wie er im Roman genannt wird, die immergleiche Frage „Warum haben Sie Asyl beantragt?“ und den obligat folgenden Wortschwall zu übersetzen. Die tragischen Kunden kommen aus Russland, haben grauenhafte Erfahrungen in Tschetschenien, im Straflager oder Jugendknast durchlebt, Greuel und Misshandlungen erlitten – und sie reden um ihr Leben, überbieten sich in drastischen Details, damit sich besagtes Paradiesestor nicht zu schnell wieder schliesst. Sie kommen „mit einem Packen Bescheinigungen aus allen nur erdenklichen Klapsmühlen, Kittchen und Knochenflickereien“ und wollen nur eines – endlich ein besseres Leben. Aber wo liegt die Wahrheit, und wo beginnt die Flunkerei? Was ist authentisch erlebt und was bloss geschickt erzählt? Die wortgewandten Simulanten, die ihre Lebenserzählung gut einstudiert haben, sind anscheinend auch recht zahlreich. „Wer ihr wirklich seid, kriegen wir sowieso nicht raus“, meint der Dolmetscher desillusioniert.
Schon die Ausgangslage hat der Autor genial gewählt. Denn worum geht es in Romanen, wenn nicht um die Kraft des Erzählens von abgrundtiefem Unglück und der Hoffnung auf ein besseres Leben? Erzählen, nichts als erzählen, um Unglück und Tod zu überwinden – dieses Urmotiv der Weltliteratur liegt dem Roman des 1961 in Moskau geborenen, 1995 in die Schweiz emigrierten Michail Schischkin zugrunde. In Russland, wo er längst die wichtigsten literarischen Auszeichnungen umgehängt bekommen hat, wird er zu Recht als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller gepriesen. Eigentlich ist das auch in Rest-Europa so, nur die deutschsprachigen Verlage hatten bisher ein Hörproblem. Doch jetzt muss alles anders werden, mit diesem von Andreas Tretner vorzüglich übersetzten Venushaar, das kein leicht konsumierbares, linear erzähltes Romänchen ist, sondern ein grandioser Erzählteppich aus tausendundeiner Geschichte. Ob Agatha Christies Zehn kleine Negerlein, Xenophons Schilderung der Kämpfe im Perserreich, die Geschicke einer Sängerin, deren Leben das 20. Jahrhundert umspannt, oder die reichbestückten Tresore der russischen Literatur – Schischkin hüpft leichtfüssig, aber anspruchsvoll und tiefschürfend zwischen den Erzählwelten hin und her, mischt Stimmen und Spuren, die Epochen und Räume auf atemberaubende Weise.
Nur eins der sattsam bekannten postmodernen Spielchen? Nein, die Geschichten sind ernst und beklemmend. Von der verstümmelten Frauenleiche im Kamin bis zum tschetschenischen Foltervideo – Schischkin versammelt keine Sirup-Episoden, das Erzählte offenbart eine zutiefst heillose Welt. Der „Graue“ bei der Armee, der die „Frischlinge“ quält und demütigt, wird zur Parodie Gottes. „Sag mal, Grauer, wie hast du diese Welt nur so hinbekommen?“
Natürlich berühren all die Flüchtlingsschicksale den Dolmetscher, der selber ein Pendler zwischen den Welten ist. „Zu Hause gleich alles zu vergessen, was tagsüber gewesen ist, das funktioniert nicht. Man trägt es bei sich. Diese Menschen, diese Reden – man wird sie nicht los.“ Aus dem Frage-und-Antwort-Schema wird allmählich ein Selbstverhör. Je enger der Mann umzingelt ist von den wimmelnden Erzählstoffen, desto mehr eigene Erinnerungen tauchen auf an eine verlorene Liebe, eine verlorene Familie. Die Vergegenwärtigung einer Rom-Reise mit der geliebten Frau, die den mythischen Namen Isolde bekommt, spricht von der Gefährdung eines Paares. Das Tristan-Phantom eines bei einem Verkehrsunfall umgekommenen früheren Geliebten legt sich wie ein lähmender Schatten über alles. Misstrauen und zersetzende Eifersucht kommen auf. Hier bebt jedes Wort vor Wehmut und dem Bewusstsein entschwundenen Glücks, hier liegt das Glutzentrum des Erzählens.
Auf die Bedrohtheit einer zarten Pflanze weist auch der nur vordergründig kokett anmutende Romantitel Venushaar. Damit ist kein pikanter Auswuchs am Körper der Liebesgöttin gemeint, sondern eine Farnart, die zwar auf römischen Ruinen als Unkraut wächst, im eisigen russischen Heimatland aber nur bei Zimmerwärme und Zuwendung gedeiht. Als Unkraut überlebt sie noch die schlimmsten Katastrophen, wächst beharrlich wieder nach. Erst die letzten, von einem traumhaften Sog vorangetriebenen Seiten dieses sehr russischen Romans enthüllen, worum es im Gewimmel der Geschichten geht: um die Überwindung des Unglücks durch das Wort. Michail Schischkin ist ein mächtig ausgreifender Erzähler und Wortgläubiger mit Klassikerpotenz, wie man ihn schon lange nicht mehr sah in der russischen Weltliteratur.
Michail Schischkin: Venushaar
Exlibris
ORF Radio Ö1, 24.04.2011
Ob man ein Buch mit dem Titel Venushaar freiwillig in die Hand nimmt, sei einmal dahingestellt! Und ob „Haar der Venus“, oder „Das Haar der Venus“ vielleicht besser klingen, darf man auch bezweifeln. Allerdings sind das auch schon die einzigen Einwände, die man gegen den großen und großartigen Roman von Michail Schischkin und (dessen nicht minder bedeutsamen Übersetzer Andreas Trettner) vorbringen könnte! Manche Buch-Titel sind offenbar unübersetzbar: „Венерин волос“ / Wenerin wolos“ hat weder mit Schamhaar noch mit Venushügel zu tun – zumindest nicht direkt. Es geht um weniger und mehr zugleich: Es geht um den Anfang und das Wort, das dort immer sein wird.
Hauptfigur ist eine „Dolmetsch“ genannte Person, die Antragsgespräche von russischsprachigen Einwanderern in die Schweiz bearbeitet; „GS“ – „Gesuchsteller“ heißt der Asylant bei den Eidgenossen. Hinter diesem Dolmetsch darf man zurecht den Autor Michail Schischkin (Jahrgang 1961) vermuten, der 1995 aus Moskau in die Schweiz emigrierte, und jahrelang als Übersetzer der Einwanderungsbehörde seinen Lebensunterhalt verdiente – bevor er zu einem der renommiertesten (und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten) russischen Schriftsteller wurde.
Weitere Personen des Romans bleiben anonym: Eine Figur heißt dann jeweils „Frage“, eine andere – „Antwort“. Das geht so:
„Frage: Führen Sie kurz die Gründe aus, weshalb Sie um Gewährung von Asyl in der Schweiz bitten.
Antwort: Mit zehn kam ich ins Heim. Unser Direktor hat mich vergewaltigt. Ich bin abgehauen. Auf einem Parkplatz habe ich Trucker getroffen, die über die Grenze fahren. Einer hat mich rausgeschafft.
Frage: Warum haben Sie den Direktor nicht bei der Polizei angezeigt?
Antwort: Die hätten mich totgeschlagen.
Frage: Wir sind „die“?
Antwort: Die stecken doch alle unter einer Decke.“
Das Leben sei kein Roman, sondern ein Film, meinte Jean-Luc Godard einmal: Wer in den Zeiten der Krise des Romans sich nicht damit zufrieden gibt, dass Romane nur noch Krimis sein sollen, der muss sich auf die Suche nach neuen Formen machen. Der Dialog des Fragebogens, der die größere Form des inneren Zwiegespräches in den Raum stellt, ist eine solche: Sogleich beginnen verschiedene Ebenen – das Leben des Dolmetschers, das Scheitern seiner Ehe – und jenes der Fremden ineinander zu verschwimmen: Da gibt es einen Russen, der aus dem Krieg in Tschetschenien floh; einen anderen Rabauken aus Minsk, der dem Übersetzer nahe legt, es lieber mit der Pflichtanwältin zu treiben, einen Polizisten von der kasachischen Grenze, der vor lokaler Korruption floh; allgegenwärtig sind dabei Gewalt und Grausamkeit. Die beiden Ebenen zerfließen auch, weil dahinter noch ein allmächtiger Romanautor am Werk ist, der seinerseits in Xenophons Anabasis liest, und ausufernde Überlegungen über Krieg und Vertreibung, über die Mythologien sibirischer Schamanen und die Kämpfe diverser Völker anstellt. Dessen nicht genug – gibt es da schließlich auch noch die Geschichte von Bella, der Romanzensängerin Isabella Jurjewa – die Geschichte einer Frau aus deren Innenperspektive, eine Geschichte vom Widerstand gegen Mord und Todschlag, von der Stärke und Kraft der Frauen überhaupt, die diese rabiate Welt zusammenhalten.
Diese vier zeitlich und räumlich, geographisch und geschichtlich getrennten Ebenen werden in einem schillernden Universum von Paralleluniversen ineinander verwoben und verschachtelt. Überraschenderweise findet man sich lesend darin nach einiger Zeit auch ganz gut zurecht. Der Zweck der Übung: Thema und Variation. Das Thema – ist die Formel: „Das Ich ist ein anderer“ – die Variation: „Doch dieser Andere sind viele.“ Es gibt dazu eine Urszene, in der alles wie in einem Nukleus enthalten ist: Der Erzähler erfährt vom Tod der Sängerin und bekommt das Angebot, deren Biografie zu schreiben – das Ganze spielt im Zentrum von Moskaus, auf dem Alten Arbat, wo der Erzähler seine Kindheit verbrachte:
„Als er ihren Namen hörte, sah er augenblicklich die Kellerwohnung am Starokonjuschennij Pereulok vor sich und den vorsintflutlichen elektrischen Plattenspieler mit dem kaputten Tonarm, den sein Vater, ein alter U-Boot-Matrose, mit blauem Isolierband umwickelt hatte. Auf ihm ließ der künftige Junglehrer unermüdlich seine Kinderschallplatten mit Cipollino, dem Zwiebelchen, und dem Riesenmilizionär Onkel Stjopa laufen, der Vater wiederum seine alten, schweren schwarzen Scheiben, wofür die Geschwindigkeit von 33 auf 78 umzustellen war.“
Wenn der Vater betrunken nach Haus kommt, legt er sich die schon Jahrzehnte alten Platten der Jurjewa auf, die Mutter ergreift sogleich die Flucht und platziert das Kind als Schutzschild gegen die Begehrlichkeit des Ehemannes in der Mitte des elterlichen Ehebettes. Dieselbe Geschichte von Liebe, Treue, Eifersucht und Trennung wiederholt sich später im Leben des Dolmetschers, nachdem er unabsichtlich im Tagebuch seiner Schweizer Ehefrau gelesen hat: Isolde, besagte Ehefrau, berichtet darin ihrem bei einem Autounfall gestorbenen ersten Ehemann Tristan vom Leben mit dem Dolmetsch: schläft sie mit diesem, denkt sie an jenen. Das Leben ist eine Höllenfahrt, in der immer nur einige Faktoren an der Oberfläche bekannt sind. Lakonisch heißt es dazu: „Und es stellte sich heraus, dass auch der Dolmetsch nur die Kopie eines verlorenen Originals war.“ Diese Ehe wird – trotz mehrfacher Versuche, sie zu kitten, scheitern.
Die – aus der Perspektive ihres fiktiven Tagebuchs – erzählte Geschichte der Sängerin Isabella Jurjewa spielt in der Zeit des Ersten Weltkriegs, im russischen Bürgerkrieg und zu Beginn der Sowjetmacht — zwischen Rostow, Petrograd, Paris und Moskau. Ihr erster in einer langen Reihe von Verehrern und Liebhabern fällt im 1. Weltkrieg, Jurjewas Karriere beginnt mit Theaterstücken von Ibsen und vor allem Gogols Revisor – am Anfang der Sowjetmacht steht die Aufspaltung in Rote und Weiße, in eine vergangene bürgerliche Kultur und eine brutale neue Staatsmacht. Die Niederlage der ersteren mit ihren tragischen individuellen Schicksalen wird auf ewig in Romanzen besungen und beklagt. Die ganze Tragödie wiederholt sich am Ende der Sowjetmacht, wer sich daraus retten kann, flieht. Alles dreht sich im Kreis.
Der Dolmetsch führt an Tristans Todestag ein Video voller Grausamkeiten aus dem Tschetschenienkrieg vor – Isolde verlässt weinend das Zimmer („Ich hasse dich“), ein Flüchtling berichtet von den Gewalttätigkeiten aus seiner Kaserne: „Als ich zum ersten Mal Ausgang bekam, sagte der Graue zu mir: Du bringst eine Flasche mit herein. Wenn nicht, fick ich dich das nächste Mal vor versammelter Mannschaft in den Arsch. Kannst dir dein Loch schon salben!“
Der erzählerische Bogen führt weiter zu den Exzessen während der Deportation der Tschetschenen im 2. Weltkrieg und mündet in einem fast mythologischen Bild, in dem die Verfolgten immer höher in die Berge des Kaukasus fliehen. Dann – die zärtliche Geste des Erzählers: Nicht alle Russen sind Schweine.
Michail Schischkin vollführt gewagte Assoziationen und Konstruktionen ohne nur ein einziges Mal auf stilistisches Glatteis zu geraten – die Welt, in den wilden Taumel polyphonen Erzählens versetzt, wird gemischt und entmischt und schließlich wird eine neue Ordnung geschaffen, die sich ständig an einer gefährlichen Grenze entlang bewegt:
„Das Ende der Welt verläuft genau hier, sehen Sie, wo die Worte aufhören. Weltkimm aus Blauschnee, scharfkantig. Dahinter das tonlose Nichts. Das Jenseits der Worte ist unbegehbar.“
In einem vielseitigen furiosen Schlussmonolog voller Anspielungen und Witz – Wachs in den Ohren weist einen Flüchtling als zeitgenössischen Odysseus aus, die ehemalige Lehrerin, die nur anhand von Kopien im Moskauer Puschkin-Museum die Schönheit klassischer Skulpturen erklären konnte, torkelt endlich durch Rom und an den bewunderten Originalen vorbei – am Schluss wird auch das Rätsel vom Haar der Venus gelöst:
“Bei uns zuhause ist es eine Zimmerpflanze, die ohne menschliche Wärme nicht überlebt, hier hingegen wächst sie als Unkraut. Adiantum capillus veneris heißt sie in der toten Sprache, die Lebendes bezeichnet. Venushaar, ein Kräutlein aus der Gattung der Frauenhaare. Gott des Lebens. Sanft schaukelnd im Wind.“
Dessen nicht genug, ergreift schließlich der Farn, das Kraut der Kräuter, selbst das Wort: „Hier wuchs ich, als eure Ewige Stadt noch nicht existierte, hier werde ich wachsen, wenn sie mal nicht mehr ist.“
Michail Schischkins Roman Venushaar ist nicht leicht, und doch einfach zu lesen: alles ergibt sich wie von selbst. Darin steht er einem Nabokov in nichts nach, die Genauigkeit und Eindringlichkeit seiner Erinnerungsbilder könnte auch von Proust stammen. Aber egal, wer die Vorbilder auch sein mögen – wie nur selten wird in diesem Buch klar, dass es auf Erden nur eine Macht gibt, die Dinge in (eine) Ordnung zu bringen: Literatur, Erzählen. Ja – und man trifft selten auf Autoren, die die Kunst mit den Wörtern mit derart offensichtlichem Vergnügen betreiben wie Michail Schischkin.
«In der Schweiz habe ich mich als Autor gefunden»
Mit Venushaar ist endlich ein Roman des russischen Autors Michail Schischkin auf Deutsch erhältlich
Von Marco Guetg
“Der Sonntag”, Nr. 13, 3.04.2011
Sechs Jahre nachdem er mit Preisen eingedeckt worden ist, kann Venushaar des Russen Michail Schischkin auf Deutsch gelesen werden. Eine Begegnung mit dem Autor, der hierzulande noch immer als Geheimtipp gilt.
Für seinen Roman Die Eroberung von Ismail erhielt er den russischen Booker-Preis für den besten Roman. Das war im Jahr 2000. Sein Roman Venushaar wurde mit dem angesehenen russischen Preis «Nationaler Besteller» ausgezeichnet. Das war im Jahr 2005. Ein Jahr später kam «Das grosse Buch», der wichtigste Literaturpreis Russlands, dazu. Seither ist Michail Schischkin (50) der einzige Schriftsteller, der alle drei grossen russischen Literaturpreise erhalten hat.
Ein literarischer Grand Slam mit Wirkung. Schischkins Romane eroberten die Welt. Italiener können sie lesen, Serben, Letten, Chinesen . . . in 14 Sprachen sind seine Romane übersetzt worden – aber noch nie ins Deutsche. Das erstaunt. Deshalb wollen wir an diesem Nachmittag wissen: Warum? Michail Schischkin schaut den Fragenden mit fragendem Blick an: «Dafür hätte auch ich gerne eine Erklärung.» Denn was er jeweils hören musste in den Häusern Suhrkamp und Co., lässt er nicht gelten: dass seine Texte zu anspruchsvoll seien. «Ich finde es erniedrigend», sagt Schischkin, «wenn Verleger ihre Leser für dumm verkaufen.»
SCHISCHKIN FAND SEINE LESER. Wie viele es in Russland sind? Wieder trifft den Fragenden ein fragender Blick. «Ich kenne die Auflage meiner Bücher nicht», sagt Schischkin, «denn die Zahlen der Verlage sind in Russland immer gefälscht.» Und wo keine Zahlen geliefert werden, gibt es auch kein Geld. «Von der Eroberung von Ismail, einem sehr gut verkauften Buch», klärt Schischkin auf, «habe ich keine Kopeke gesehen.» Von Venushaar fast keine. Sein dritter Roman mit dem deutschen Arbeitstitel «Briefsteller» erschien vergangenen August in einem neuen Verlag. Nun hofft Michail Schischkin, dass ihn am neuen Ort niemand übers Ohr hauen wird.
In Moskau verdiente sich der Germanist und Anglist sein Brot als Lehrer, in Zürich begann er als Dolmetscher und Übersetzer. Doch seit seine Auftraggeber wissen, dass seine ausserliterarischen Tätigkeiten immer auch literarisches Material abwerfen, ist diese Geldquelle versiegt. Seither lebt Schischkin von Preisen, Honoraren, Stipendien, und er musste auch schon als Bittgänger beim Sozialamt anklopfen – «eine sehr unangenehme Angelegenheit».
Einen realen Hintergrund hat auch die Hauptfigur im Roman Venushaar, der seit Mitte März auf Deutsch erhältlich ist und dessen Lektüre eine Ahnung dessen gibt, was gerne als «anspruchsvoll» apostrophiert wird. Dröseln wir die Struktur dieses Romans auf. Eine Ebene ist in der Schweiz angesiedelt. Dort treffen wir auf einen Dolmetscher bei seiner Fragerei. Das ist biografisch verbürgt. Schischkin dolmetschte für die Schweizer Einwanderungsbehörde. Andererseits nutzt Schischkin diesen Frage-und-Antwort-Reigen zu fiktionalen Kopfgeburten und treibt uns damit in eine Welt der Kriegsgräuel und der Verfolgung. Quasi zur Erholung liest der Dolmetscher dann wiederum in den Arbeitspausen Xenophons Anabasis, Schlachtenschilderungen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus.
In diese Ebene eingeschoben werden immer wieder Bruchstücke zweier weiterer Geschichten: jener der gescheiterten Ehe des Dolmetschers und Tagebuchnotate der Sängerin Isabelle Jurjewa, die von 1899 bis 2000 lebte. Über ihren Blick wird ein Jahrhundert besichtigt.
ANSPRUCHSVOLL? Michail Schischkin wehrt sich: «Es ist ein klar strukturiertes Buch mit verschiedenen Erzählsträngen, die ineinanderlaufen.» Venushaar enthält zwei Liebesgeschichten und viele Lebensgeschichten. Erzählt werden sie auf der Folie der Schweiz als erhofftes Paradies wie der Geschichte Russlands des 20. Jahrhunderts. Diese Menschen- und Flüchtlingsschicksale sind letztlich nichts anderes als Ausdruck der generellen Sehnsucht des Menschen nach einem anderen und hoffentlich besseren Leben. So unterschiedlich sind diese unterschiedlichen Biografien im Kern gar nicht. Michail Schischkin: «Alle Figuren haben etwas, das sie vereint: ihre Eltern, ihre Kinder, ihr Tod.» Und alle haben eine Sehnsucht: nach Liebe, nach Anerkennung und Überwindung des Todes.
Michail Schischkin, der perfekt Deutsch spricht, lebt seit 1995 in der Schweiz – «nicht als Emigrant». Auf diese Feststellung legt der Autor Wert. In Moskau hatte er eine Schweizer Slawistin kennen gelernt und zog wegen der Geburt des gemeinsamen Sohnes nach Zürich. Schischkin war ein Liebesflüchtling, er wollte gar nicht weg. «Russland war spannender zu jener Zeit, dort kannte ich auch die unsichtbaren Fäden der russischen Gesellschaft. In der Schweiz war ich ein Blinder» – künstlerisch allerdings ist er hier ein Sehender geworden. «Alle meine wichtigen Romane habe ich in der Schweiz geschrieben. Hier habe ich mich als Autor gefunden. Deshalb bin ich diesem Land sehr dankbar.» Ob er auch abstimmt und wählt? Wieder schaut Schischkin den fragenden Schweizer an: «Wissen Sie», sagt er, «ich komme aus Russland, wo Wahlen jeweils nichts verändern. Deshalb wollte ich nach der Einbürgerung meine Rechte unbedingt wahrnehmen. Und was habe ich festgestellt? Ich verliere immer – genau wie in Russland. Seither lasse ich es bleiben.»
Das Ich und seine Geschichten
Michail Schischkin spielt in Venushaar kunstvoll mit Wirklichkeitserzählungen und Identitäten
Von Ulrich M. Schmid
Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Michail Schischkin lebt seit fünfzehn Jahren in Zürich, ist mittlerweile Schweizer Staatsbürger und hat in Russland mit seinen vier Romanen alle wichtigen Literaturpreise abgeräumt – hierzulande wird er aber nur als Essayist und Historiker wahrgenommen. Ausländische Verlage haben sich längst um Schischkin gekümmert – seine Bücher sind ins Französische, Italienische, Chinesische, Norwegische und Serbische übersetzt worden. Mit Venushaar liegt nun endlich ein zentraler Schischkin-Roman auch auf Deutsch vor.
Möglicherweise hängt die zögerliche Entdeckung Schischkins im deutschsprachigen Raum mit der anspruchsvollen Poetik seiner Texte zusammen. Schischkin erzählt nicht linear, sondern montiert einzelne Episoden wie Filmausschnitte. Dabei verwischen sich oft die Grenzen zwischen Autobiografie, Geschichte und Fiktion. Venushaar verwebt drei Handlungsstränge: Die Erzählung setzt mit einer Szene im Auffangzentrum Kreuzlingen ein, wo der «Dolmetsch» (hinter dem unschwer der Autor selbst zu erkennen ist) russischsprachige Asylsuchende interviewt. Die GS – der Roman übernimmt hier die unsensible Abkürzung der Schweizer Bürokratie für «Gesuchsteller» – erzählen Geschichten von bestialischer Brutalität. Der Dolmetsch weiss indes, dass die Geschichten zwar wahr sind, aber nicht zu den Erzählern gehören. Das Asylverfahren wird aus dieser Sicht zu einem literarischen Wettbewerb: Wer die dramatischste Geschichte erzählt, wird in das Konsumparadies Schweiz aufgenommen.
In diesem Stimmenkonzert gibt es aber auch Pessimisten, die ihr eigenes Elend in eine wüste Pöbelei gegen alle Instanzen der Schweizer Staatsordnung verwandeln. Für die unterprivilegierten Osteuropäer ist die bürgerliche Wohlanständigkeit in diesem Fall nur noch eine Provokation – ein inhaftierter Asylbewerber überhäuft seine Pflichtverteidigerin mit sexuellen Flüchen. Neben das Ordinäre tritt das Klassische: Schischkin überblendet in seinem Roman die protokollarische Wiedergabe der Interviews mit Asylsuchenden mit der Lektüre von Xenophons Anabasis. Der Dolmetsch liest in den Arbeitspausen in diesem Kriegsbericht aus dem 4. Jahrhundert vor Christus – die Aussagen der Migranten über Kriegsgreuel und Verfolgung lösen sich in den Schlachtschilderungen der alten Griechen auf.
Der Dolmetsch tritt jedoch nicht nur als Geschichtensammler auf, sondern auch als Privatperson. Nach einer Scheidung lebt er allein in einer kleinen Wohnung neben einem Zürcher Friedhof. In seiner Einsamkeit denkt er oft an seine Frau, die er als Isolde anspricht. Diese Erinnerung wird von einer klassischen Dreiecksgeschichte dominiert: Isolde war früher mit Tristan liiert, der aber bei einem Autounfall in Italien ums Leben kam – Isolde selbst überlebte mit zahlreichen Knochenbrüchen und schweren Verletzungen. Der Dolmetsch las während einer gemeinsamen Italienreise ein geheimes Tagebuch seiner Frau, in dem sie gestand, beim Geschlechtsakt mit ihm immer nur an Tristan zu denken. Das doppelte Geheimnis der Eheleute (sie wusste nicht, dass er wusste, dass sie heimlich immer noch Tristan liebte) führte schliesslich zur Trennung: Der Dolmetsch war eifersüchtig auf einen Toten – seine Aggression konnte sich deshalb nicht gegen den Rivalen richten, sondern nur gegen die geliebte Frau selbst.
Dieser Teil der Romanhandlung ist höchst autobiografisch: Schischkin verarbeitet seine eigene gescheiterte Ehe mit einer Schweizer Slawistin – wie ein GS erzählt er eine Geschichte von äusserster Grausamkeit, die aber nicht ihm, sondern dem «Dolmetsch» passiert ist. Die Ironie des Romantextes liegt darin, dass Schischkin das eigene Familiendrama als die Tragödie eines Fremden erzählt und so die Aussagesituation der Geschichten der Asylsuchenden in ihr Gegenteil verkehrt.
Schischkin verdichtet seine Darstellung, indem er über sich selbst in der dritten Person spricht – er tritt konsequent als Dolmetsch auf, der zwischen den Sprachen, Geschichten und Schicksalen der anderen vermittelt. Die Form der Autobiografie findet sich aber trotzdem im Roman: Ein dritter Handlungsstrang besteht aus den fiktiven Tagebucheinträgen der Sängerin Isabella Jurjewa, die von 1899 bis 2000 lebte und mithin zur Zeugin des 20. Jahrhunderts wurde. Der Dolmetsch hatte noch als junger Autor in Moskau von einem Verlag den Auftrag erhalten, eine Biografie der Sängerin zu schreiben. Dieses Material findet nun nicht als distanzierte Lebensbeschreibung, sondern als unmittelbares Zeugnis Eingang in Schischkins Roman: Isabellas pubertäres Wechselbad der Gefühle während der Wirren des Ersten Weltkriegs und der Revolution wird in genau jener intimen Ich-Form präsentiert, die der Erzähler für seine eigene Lebensgeschichte so sorgsam vermeidet.
Venushaar ist einer der wichtigsten Romane der russischen Gegenwartsliteratur. Literarisches Stilempfinden, psychologischer Scharfblick und kompositorisches Gefühl bilden gemeinsam die Grundlage für einen meisterhaften Text, der das Romangenre neu definiert. Michail Schischkin verfügt über ein feines Gehör für die Selbsttäuschungen seiner Protagonisten (inklusive der Erzählerfigur) und verbindet ihre Geschichten zu einer raffinierten Konstruktion, bei der auch ein Vladimir Nabokov vor Neid erblassen könnte.
Das Ministerium für Paradiesverteidigung
Von Dominik Riedo
“Schweizer Monatshefte”, Januar 2011
«Ihr seid doch keine Menschen, ihr seid doch feuchter Lehm! Geformt hat man euch wohl, doch etwas einzuhauchen vergass man!» So brüllt einer der eigentlich Schutzsuchenden vor dem Schreibtisch der Einwanderungsbehörde. «Derweil richtet Petrus die Dinge auf seinem Schreibtisch fein säuberlich aus – als wollte er, Tischvorsteher sozusagen, die Parade seiner Bleistifte und Zahnstocher abnehmen. Er kriegt die Zeit bezahlt. Keine Eile. Petrus ist ein ordnungsliebender Mensch.»
Seit 1995 lebt der russische Autor Michail Schischkin in Zürich. Längere Zeit hat er als Dolmetscher für das Amt für Migration gearbeitet. Dabei hat er genau beobachtet und ein feines Ohr entwickelt für die Dialogführung zwischen Antragsstellern und Staatsbeamten. Und immer wieder musste Schischkin die Frage ins Russische übersetzen, warum jemand in der Schweiz Asyl beantrage. Wie es nun der namenlose Erzähler im Roman Venushaar tun muss.
Auch dieser Erzähler ist Immigrant. Doch beim Übersetzen der fremden Geschichten, des erlebten Leids, der gespannten Hoffnungen und der schreienden Verzweiflung legt sich seine eigene Lebensgeschichte wie eine zweite Schicht um das Übersetzte. Das Anerlesene und Erlernte, Erinnerungen und Gefühle vielerlei Geschichten aus anderen Welten und Zeiten wickeln sich wie eine dritte, vierte, fünfte und x-fache Schicht um das, was gerade in einem Büro der Schweizer Behörde protokolliert wird. Dadurch hat der Leser nicht nur sogenannt reale Szenen und Fragen dieses Amts vor sich wie: «Sag mir doch mal, mein Bester, wie viel Kilometer sind es von deinem Kaff bis in die Hauptstadt?» (was per Handbuch überprüft wird), sondern zunehmend trifft er auf solche Dialoge: «‹Welche Sprache wird im Königreich der Chaldäer gesprochen?› – ‹Akkadisch!› kommt die Antwort. ‹Und wie heisst der Tempel für den Gott Marduk in Babylon?› – ‹Esagil!› – ‹Und der Turm daselbst?› – ‹Etemenanki.›»
Auf faszinierende Weise erzählt Schischkin derart wie nebenher ein Jahrhundert russischer Geschichte bzw. Ungeschichte (etwa Vorfälle in einem der berüchtigten Gefängnisse der Sowjetzeit: «Ich zerschlug die Glühbirne und schlitzte mir die Bauchdecke auf. Die Schnitte muss man so legen, dass die Därme austreten, in solchen Fällen ist den Haftärzten das Risiko zu gross, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.») und bettet ausserdem das Leben des Dolmetschers durch Verweise in einen Kosmos der gesamten Weltkultur ein. Der Erzähler in Venushaar übt eben nicht nur seine Aufgabe auf dem Amt für Migration aus, sondern ist zugleich angestellt als «Dolmetsch in der Flüchtlingskanzlei des Ministeriums für Paradiesverteidigung».
Ja, Venushaar ist tatsächlich eine vielstimmige Parabel auf das verlorene Paradies. Vor allem ist der Roman virtuos komponiert, ohne jedoch je langweilig zu werden. In etlichen Bereichen übertrifft er wohl sogar Nabokovs Bastardzeichen, das ebenfalls mit mehreren Schichten einer Lebenswelt und einer möglichen Emigration spielt. So hat Schischkin denn auch zu Recht bereits einige renommierte Preise für sein Werk erhalten.
Dazu ist Venushaar bedeutend in einer sonst eher zu oft bemühten Weise: menschlich. «Zuhause gleich alles zu vergessen, was tagsüber gewesen ist, das funktioniert nicht. Man trägt es bei sich.» Wahrlich!
Eine Frau wie ein Gebirge
Die Leipziger Buchmesse jubiliert – und fordert Russland heraus.
Von Ijoma Mangold
“DIE ZEIT” Nr. 13/2013, 21. März 2013
Martin Walser schätzt das Jasagen, das Loben, Preisen und Jubilieren. Das Neinsagen erscheint ihm dagegen als mickrig, kleinmütig und blind für die Welt. Deswegen stichelt er so gerne gegen die Kritiker, weil die immer glauben, eine Wahrheit am Wickel zu haben, nur weil sie gerade mal wieder schwarzsehen. Ein echter Kerl schwärmt. Zum Beispiel für die Schriftstellerin Eva Menasse. Die sei – und Walsers rechte Hand führt schwingende Kreisbewegungen aus auf der Suche nach dem richtigen Wort. Die Tischrunde kommt ihm soufflierend zu Hilfe: Ja, Eva Menasse sei wirklich sehr angenehm. “Ach was, angenehm! Das ist doch kein Wort für diese Frau. Der Himalaya ist auch nicht angenehm. Die ist ein Gebirge von einer Frau!” So geht Jubel.
Überhaupt ist Walser bester Laune: “Die Leipziger Buchmesse ist für mich ein Volksfest. Überall quillt das Leben. Das habe ich so in Frankfurt nie erlebt.” Nur eines nervt ihn an Lesungen. “Jedes Mal beim Soundcheck hör ich den Satz: ›Keine Sorge, wenn Leute da sind, klingt es ganz anders.‹”
Michail Schischkin ist kein lauter Mensch. Sein schönes Deutsch mit dem russisch-traurigen Singsang hat nichts Auftrumpfendes oder Proklamierendes. Der russische Schriftsteller (Venushaar), der seit zwei Jahrzehnten in der Schweiz lebt und dabei ist, zu den großen Weltautoren zu zählen, hat jetzt etwas getan, was in Russland einen Eklat auslöste. Schischkin hat die Einladung, als Teil der russischen Schriftsteller-Delegation zur BookExpo America nach New York zu reisen, abgelehnt. In einem offenen Brief erklärte er, dass er als Schriftsteller kein System repräsentieren könne, das er “abstoßend” finde. “Ein Land, in dem ein kriminelles, korruptes Regime die Macht ergriffen hat, in dem der Staat eine Verbrecherhierarchie ist, (…) in dem die Gerichte den Machthabern dienen und nicht dem Gesetz, in dem es politische Gefangene gibt, in dem das Staatsfernsehen zur Hure gemacht wurde, (…) ein solches Land kann nicht mein Russland sein.”
Schischkin hat viel Zustimmung bekommen in Russland, aber auch scharfe Attacken. Und zwar nicht nur von Regierungsseite, sondern von anderen Schriftstellern, die ihm vorwerfen, er wolle sich lieb Kind beim Westen machen. “Die Unfreien”, sagt jetzt Schischkin in Leipzig, “werden einem freien Menschen nie seine Freiheit gönnen.” Aber Schischkin strahlt kämpferischen Optimismus aus. Das Regime befinde sich in der Agonie. Noch kontrolliere es das Fernsehen, kein Oppositioneller komme da durch die Zensur. Doch im Internet sehe es anders aus: “So wie die Informationen des Internets ins Fernsehen kommen, ist es aus mit dem Regime.” Trotz der unzähligen Verhaftungen bröckle Putins Macht.
Dann fahren wir zusammen im Taxi von der Messe zurück in die Stadt. Als der Taxifahrer hört, dass er einen Schriftsteller chauffiert, will er wissen, was er schreibe? Und Schischkin sagt mit seiner zart singenden Satzmelodie: “Wie alle Schriftsteller: Bücher über die Liebe und den Tod.”
EUROPA-JOURNAL, 24. AUGUST 2012
Michail Schischkin
Der russische Schriftsteller und Journalist Michail Schischkin lebt seit mehr als 15 Jahren in der Schweiz, wo er zunächst als Dolmetscher für die Schweizer Fremdenpolizei arbeitete. Um das Schicksal von Asylwerbern aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion in der Schweiz geht es auch in seinem Roman “Venushaar”, für den Schischkin 2011 den “Internationalen Literaturpreis – Haus der Kulturen der Welt” in Berlin erhalten hat. In Russland sind seine Bücher längst Bestseller.
Beim Übersetzen von fremdem Leid
Im Mittelpunkt des Buches steht ein russischer Dolmetscher, der in der Schweiz für die Einwanderungsbehörde arbeitet. Das Buch erzählt von Einwanderwilligen, ihren Schicksalen und Familien, der Gegenwart und Vergangenheit in Russland und natürlich über den Ich-Erzähler selbst.
Von Karla Hielscher
Deutschlandfunk Kultur, 21.04.2011
Das dem Roman vorangestellte Motto aus dem apokryphen „Buch der Offenbarung Baruchs“ formuliert dessen hohen Anspruch. Da heißt es:
Denn durch das Wort ward die Welt erschaffen, und durch das Wort werden wir einst auferstehen.
Nein, eine lockere, mühelos eingängige Lektüre bietet dieses Buch nicht. Wer sich jedoch auf einige Anstrengung einlässt, erste Verständnisschwierigkeiten überwindet und sich dem Sog seiner Sprache anvertraut, der wird überreich belohnt. Höchste Zeit also, dass dieser hervorragende russische Schriftsteller endlich auch beim deutschen Leser ankommt.
Michail Schischkin, Jahrgang 1961, lebt seit den 90er-Jahren in der Schweiz, fühlt sich aber nicht als Emigrant und veröffentlicht seine Werke weiterhin zuerst in Russland. Während einige „patriotische“ russische Kritiker ihm vorwerfen, dass er sich von der satten Schweiz aus an den Schrecken Russlands ergötze, sehen ihn andere als grandiosen Fortsetzer der Tradition Bunins und Nabokovs.
Der Roman „Venushaar“ – erschienen 2005 – erhielt den Petersburger Preis „Nationaler Bestseller“ und den „Großen nationalen Buchpreis“. Und in der Theaterwerkstatt Petr Fomenko fasziniert die Theaterbearbeitung des Romans unter dem Titel „Das Allerwichtigste“ seit Jahren das Moskauer Publikum.
Wie das „Venushaar“ aus der Gattung der Frauenhaarfarne, das in südlichen Ländern seit Urzeiten alte Mauern überwuchert, jede Ruine besiedelt, den Marmor aufbricht und überall seine Sporen verstreut, so entfaltet dieser Roman ein dichtes Geflecht von Geschichten über Menschen und ihre Schicksale in unserer Welt.
Keimzelle und Ausgangspunkt des vielstimmigen, verschlungenen Textgewebes ist die Arbeit des zentralen Ich-Erzählers als Dolmetscher in der Schweizer Asylbehörde. Tagtäglich übersetzt er die erschütternden Geschichten über Gewalt, Tod, Folter und Brandschatzung von traumatisierten, ehrlichen oder lügenden Asylsuchenden, die mit diesen Horrorberichten über ihr Leben hoffen, Zugang ins gelobte Land zu erlangen:
Gut, die Leute sind vielleicht nicht echt, aber die Geschichten sind es! Wenn sie im Kinderheim nicht den mit den aufgeworfenen Lippen vergewaltigt haben, dann einen anderen! Und die Story von dem verbrannten Bruder und der getöteten Mutter hat der junge Litauer irgendwo aufgeschnappt. Ist es wichtig, wem sie genau passiert ist? Sie bleibt authentisch, so oder so. Wir sind, was wir sagen. Was im Protokoll über uns steht, das werden wir sein. Aus Worten geboren.
Michail Schischkin, der selbst in diesem Beruf in Zürich sein Geld verdient hat, verarbeitet in seinem Buch literarisch autobiografische Erfahrungen, und man spürt, dass sein Schreiben einem tiefen inneren Bedürfnis entspringt.
Zu den wuchernden Geschichten der Asylanten, die sich in Frage-Antwort-Form immer weiter verzweigen, kommen Erinnerungen an Kindheit, Schule und erste Liebe zu Sowjetzeiten, an seine Arbeit als Junglehrer, den Beginn seiner Schriftstellerlaufbahn, sein Leben als Gatte und Vater.
Eigentlich enthält das Buch mehrere Romane: die Moskauer Jugend- und Schulgeschichten, konzentriert um die Gestalt der ungeliebten, unansehnlichen und doch so engagierten Lehrerin Galina Petrowna, der Galpetra; die in der kulturgesättigten Landschaft Italiens und in Rom angesiedelte bittersüße Geschichte der Ehe und Trennung des Dolmetschers von Isolde und seinem geliebten Kind; das ausführliche Tagebuch der berühmten, aus einer großbürgerlich liberalen Familie in Rostov am Don stammenden Romanzensängerin Isabella, das in ihrem privaten Schicksal die Geschichte und Kulturgeschichte Russlands im 20. Jahrhundert spiegelt; die halbfantastischen, nicht abgesandten Briefe an den in Russland lebenden Sohn, in denen er in einem wilden Bewusstseinsstrom seine Erinnerungen und Gedankenfetzen ausbreitet.
Der ganze Text ist – und das macht seine Einzigartigkeit aus – wie mit immergrünem Venushaar durchzogen von Gestalten und Bildern der Bibel, antiker Mythen und den Legenden sibirischer Stämme, von Lektüreelementen, Zitaten und Anspielungen aus der Weltliteratur. Immer wieder werden die Grenzen der Zeiten und Räume durchstoßen und fließen ineinander, das Historische wird zum mythisch Ewiggleichen. Die sommerliche Geschichte der antiken Hirten Daphnis und Chloe, die als Säuglinge vertauscht wurden, wird zum Beispiel wie ein Handschuh anderen Gestalten übergezogen und ins eisige heutige Sibirien versetzt. Der antike mythische Reisebericht eines Grenzgängers geht – mit plötzlich auftauchenden konkreten Details wie der gezuckerten Kondensmilchkonserve, die mit dem Bajonett geöffnet wird – in einen Bericht über die russische Armee von heute mit ihren brutalen Demütigungsritualen über. Oder die Lektüre von Xenophons „Anabasis“ über den Feldzug der Griechen gegen Arthaxerxes im 4. Jahrhundert vor Christus vermischt sich mit den Berichten über die erbarmungslose Deportation der Tschetschenen durch Stalin im zweiten Weltkrieg. Auf ihrer Flucht in die Berge stoßen die vom Kältetod bedrohten Tschetschenen auf brennende Lagerfeuer mitten im Schnee:
Die Bewohner des Auls sprachen sie an: fragten, ob sie sich an den Feuern wärmen dürften, baten um etwas zu essen. Die Griechen teilten mit den Tschetschenen das wenige, was sie hatten. Xenophon versuchte den müden, durchfrorenen, ausgehungerten Menschen, die kein Griechisch verstanden, begreiflich zu machen, dass er seine Leute zum Meere führte. „Thalatta!“, rief Xenophon und wies den Ältesten die Richtung zum Meer. „Thalatta!“. Und am anderen Morgen machten sie sich gemeinsam auf den Weg.
Im manchmal ausufernden Text mit seinen zahllosen Geschichten, die durch ein feines Netz von Wiederholungsstrukturen zusammengehalten werden, wechseln ganz unterschiedliche Erzählrhythmen miteinander. Auf Passagen, in denen die Schreckensgeschichten der Asylsuchenden dicht ineinander geschachtelt sind wie Matrjoschkas, die russischen Puppen in der Puppe, folgt mit den einfachen und sehr persönlichen Tagebuchaufzeichnungen der Schülerin und später erfolgreichen Künstlerin Bella eine linear erzählte Lebensgeschichte. An mit Bildungsgut, Anspielungen und Zitaten gefüllte assoziative Bewusstseins- und Bilderstromprosa schließt ein psychologisch realistisch genau erzählter Liebes- und Eheroman. Diese Vielfalt des Stils präzise zu erfassen, ist eine enorme Leistung des Übersetzers Andreas Tretner.
Es ist ein Buch über die Erinnerung, das Erzählen, darüber, dass in der Welt nur bleibt, was erzählt, was aufgeschrieben wird. Es ist ein Buch über die wunderbare Bestimmung von Kunst und Literatur als Gedächtnis, ohne die das Jahrtausende währende Leben aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden, ausgelöscht wäre.
Ja, es ist ein Buch über die Auferstehung des Fleisches im Wort:
Aus dem Nichts, aus der Leere des Raumes, aus dem grauen Putz, aus einer Fläche Schnee, aus dem weißen Blatt Papier tauchen plötzlich Menschen hervor, erstehen lebendigen Leibes, und dies, um für immer zu bleiben; dass sie ein weiteres Mal untergehen, kann nicht sein, denn den Tod haben sie ja schon hinter sich. Zuerst nur in Umrissen. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Vorzeichnung. Ein Mensch erstreckt sich von der Ritze hier in der Wand bis zu dem Sonnenfleck dort. Dehnt sich von den Fingernägeln zu den Zehenspitzen. Hände, Füße, Köpfe, Brüste Bäuche – alles aus dem Schnee, dem Nebel, der Weiße des Papiers geholt, jetzt hier ausgelegt zur Identifizierung. Die Körper noch durchsichtig wie der Schatten eines leeren Glases an der Wand. Die Realität ist nachgiebig. Das Fleisch ersteht schrittweise. Hier fehlen noch die Arme, bei dem da die Beine – so wie bei den Statuen im Vatikanischen Museum, und zwischen den Beinen hat der Hammer gewütet …
Michail Schischkin arbeitet durchaus mit den literarischen Verfahren der Postmoderne: einer Fülle von Zitaten, dem Ineinander von Zeiten und Räumen, dem anachronistischen Verbinden von Details unterschiedlicher historischer Epochen, der Uneindeutigkeit des erzählenden Subjekts. Er nutzt diese Mittel jedoch nicht zur Zerstörung, zum zynischen Spiel, zum Bruch mit der Tradition. Schischkin stellt sich und sein Schreiben mit großem Ernst in eine Erzähltradition der Weltliteratur, die als ihren Sinn die Bewahrung, das Aufheben des menschlichen Lebens in der Kunst erstrebt.
Lesen gegen die Erniedrigung
Venushaar ist der erste ins Deutsche übersetzte Roman von Michail Schischkin. In Russland ist der Autor längst ein Star, hierzulande wird er gerade als Entdeckung gefeiert, aktuell auch beim Sprachsalz Festival. Ein Gespräch.
Von Ivona Jeicic
“Tiroler Tageszeitung”, 10 September 2011
Treffpunkt Parkhotel Hall, wo Michail Schischkin bis Sonntag beim Sprachsalz-Festival zu Gast ist und am Sonntag (16 Uhr) nochmals aus seinem Roman Venushaar lesen wird. Für das Buch, in deutscher Übersetzung erschienen im März 2011 bei DVA, wurden Schischkin wie auch sein Übersetzer Andreas Tretner mit dem Internationalen Literaturpreis des Berliner Hauses der Kulturen der Welt ausgezeichnet. In seiner Heimat Russland ist der in der Schweiz lebende Autor mit Preisen längst hochdekoriert. Die Interview-Anfrage erscheint ihm dennoch nicht ganz geheuer. Ob sie Venushaar gelesen habe, erkundigt er sich vorsichtig bei der Interviewerin. Hat sie. Und ist eingetaucht in einen ungeheuer dichten, mitreißenden Strom an Geschichten, die bei den Fragen eines „Dolmetsch“ an Asylbewerber beginnt, tief in dessen eigene und in die russische Geschichte des 20. Jahrhinderts hineinführt, und dabei strotzt vor literarischen Bezügen, Verweisen und Zitaten von Gogol bis zur griechischen Antike, von Brodsky bis zu den Volksmärchen.
Venushaar ist in Russland bereits 2005 erschienen, aber erst in diesem Frühjahr in der deutschsprachigen Übersetzung. Warum hat das solange gedauert?
Das ist eine gute Frage. Ich würde darauf auch gerne eine Antwort bekommen. Gerade die Verlage, die eigentlich eine solche Literatur herausgeben sollten, haben abgelehnt. Vielleicht fanden sie das Buch zu anspruchsvoll und hatten Angst, dass es sich nicht gut verkaufen würde. Der Verleger hat ein bestimmtes Leserbild im Kopf und diesen Leser will er bedienen. Ich finde es aber sehr frustrierend, dass die Verleger ihre Leser für dumm halten. Dabei ist das Buch aus meiner Sicht gar nicht anspruchsvoll. Es ist sehr einfach gebaut, sehr einfach geschrieben.
Aber Sie gehen wohl doch von einem anspruchsvollen Leser aus, als es offenbar manche Verleger tun?
Ich habe immer für meinen idealen Leser geschrieben, der neben mir stand und immer mit mir einverstanden war. Er hat den gleichen Geschmack, wählt die gleichen Worte, hasst die gleichen Worte. Beim Schreiben hilft das. Aber danach läufst Du natürlich Gefahr, dass du mit diesem Leser allein bleibst. Ich warf auch nie sicher, ob meine Bücher publiziert werden, aber es gab keine Wahl. Das ist wie mit Kindern. Du kannst dein Kind nicht planen: Es hat braunes Haar oder grüne Augen. Es ist so, wie es ist.
Sind die Reaktionen der deutschsprachigen Leser anders als die der russischen?
Vorigen Sommer habe ich eine Lesereise im Norden von Russland gemacht und bin da in eine kleine Stadt gekommen. In der Bibliothek versammelte sich die Intelligenz der Provinz: die Ärzte, die Lehrerinnen, die Bibliothekarinnen. Und ich habe gesehen, dass für diese Leute mein Buch wirklich sehr wichtig war. Ich kann mir vorstellen, was im russischen Leser vor sich geht. Ich identifiziere mich mit ihm. Als ich 16, 17 war, war das Lesen sehr wichtig für mich. Um mich herum gab es diese erniedrigende Realität, die Lüge. Das Lesen hat meine menschliche Würde gerettet, damit konnte man sich einen Raum schaffen. Und jetzt, als ich mit den Leuten in dieser kleinen Stadt gesprochen habe, habe ich festgestellt: Wir leben jetzt in einem anderen Land, es heißt nicht mehr Sowjetunion, es heißt Russland, wir haben keine Kommunisten mehr, wir haben Kapitalisten, aber die Situation ist die gleiche: Die Realität ist absolut erniedrigend. Die kommunistische Lüge wurde durch die demokratische Lüge ersetzt. Diese Realität ist genauso erniedrigend. Und as Lesen spielt die gleiche Rolle. Es rettet die menschliche Würde.
Weil es eine Flucht ist?
Es geht nicht um die Flucht. Man flüchtet in den Vodka. Mit der Literatur ist es etwas anderes. Man rettet sich. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich werde nie vergessen, wie nach der Veröffentlichung meines ersten Romans Die Eroberung Ismails eine Frau zu mir kommt und sagt: „Sie haben meinen Glauben an die russische Literatur gerettet.“ Das Lesen spielt also eine ganz andere Rolle in Russland. Es ist wie ein Rettungsring. Ich weiß nicht, was es hier für die Leute bedeutet. Vielleicht ist das Lesen einfach das Lesen.
Um Erniedrigung geht es auch im Venushaar, wenn Asylbewerber vor Beamten der Schweizer Einwanderungsbehörde ihre Geschichten erzählen und als Lügner oder schnell abzulehnende Fälle abgestempelt werden.
Das ganze Leben besteht aus Erniedrigung. Aber für diese Leute besteht das Leben auch aus schlimmeren Dingen. In jeder Gesellschaft, bei jedem Regime, ist es immer die Frage: Wie viel bist du bereit, von deiner Würde zu opfern, um z.B. deinen Kindern die Ausbildung zu ermöglichen, ein Stück Brot zu ermöglichen? In verschiedenen Zeiten und verschiedenen Ländern ist der Grad der Erniedrigung unterschiedlich.
Sie haben selbst als Übersetzer für die Einwanderungsbehörde gearbeitet, wie belastend war das?
Als ich mit meiner Familie in die Schweiz gekommen bin, habe ich mich selbständig gemacht und als Dolmetscher und Übersetzer gearbeitet. Für mich war das ein Job, ich wollte Geld verdienen. Aber es ist kein normaler Job. Es belastet, geht unter die Nägel, in die Seele hinein und bleibt dort. All diese Geschichten. Meine Hauptfigur arbeitet im „Ministerium für Paradiesverteidigung“. Von der Geschichte, die ein Asylbewerber dort erzählt, hängt nichts ab, alles hängt von der Quote ab. Ist die schon erfüllt, dann passen die anderen nicht mehr hinein, obwohl ihre Geschichte vielleicht gar nicht schlechter ist. Das Buch fing für mich an mit meinem Entsetzen darüber, wie zynisch das alles geworden ist.
Ein Erzählstrang folgt der Sängerin Isabella Jurjewa und damit einem ganzen Jahrhundert russischer Geschichte. Jurjewa hat tatsächlich gelebt?
Sie war von Kindheit an bei uns in der Wohnung, mein Vater hat all die alten Schallplatten gehört. Aber eigentlich hat der Roman begonnen, als meine Mutter mir vor ihrem Tod ihre Tagebücher gegeben hat, die sie als Studentin und Schülerin Ende der 1940er, Anfang der 50er Jahre geschrieben hat. Das war die schlimmste Zeit in der Sowjetunion: Finsternis, Angst, Verfolgung. Davon aber gab es nichts in diesen Tagebüchern. Darin gab es nur ein junges Mädchen, das sich nach der großen Liebe sehnt, das glücklich ist, weil es regnet oder weil es schöne Bücher liest. Ich war erstaunt darüber, wie sie so naiv sein konnte. Erst später, nachdem ich das Familienarchiv meinem Bruder gegeben habe, sein Haus abgebrannt ist und alles zerstört war, habe ich plötzlich verstanden, dass das keine Naivität eines Mädchens war, sondern tiefe Weisheit: das Streben nach Liebe ist unsere einzige Rettung. Aber ich konnte keinen Roman über meine Mutter schreiben, also habe ich Bella genommen, die das 20. Jahrhundert durchlebt hat. Und sie hat nur an die Liebe geglaubt.
Venushaar ist ja das Motiv des Romans: in Rom ist diese Pflanze Unkraut, aber in Russland ist es eine Zimmerpflanze, die ohne menschliche Wärme stirbt. Und das ist ein Roman über die menschliche Wärme.
Der Roman als Dolmetsch eines russischen Jahrhunderts
Von Wolfram Schütte
TITEL Kulturmagazin. 16. Juni 2011
Um es gleich vorweg zu sagen: Man muss der DVA sehr dankbar sein, dass sie uns nun mit seinem schon 2005 erschienenen Roman ›Venushaar‹ einen Autor vorstellt, der allein aufgrund dieser 536 Seiten ohne Zweifel zu den literarischen Größen unserer Gegenwart zählt.
Dabei lebt der 1961 in Moskau geborene Michael Schischkin seit 1995 in Zürich, wo er u.a. als Dolmetscher der Einwanderungsbehörde arbeitete. In seine neue Heimat – denn mittlerweile ist Schischkin Schweizer – kam der russische Linguistiker nicht aus politischen, sondern erotischen Gründen. Er hatte sich in Moskau in eine Schweizer Slawistin verliebt.
Aber als Autor, der schon u.a. ein heute vergriffenes Buch über ›Die russische Schweiz im Zürcher Limmat-Verlag publiziert hat, schreibt er weiterhin russisch, und in Russland hat er mit seinen bislang vier Romanen auch schon fast alle Preise gewonnen. Mit ›Venushaar‹, behauptet sein deutscher Verlag, sei ihm nun der Durchbruch zur internationalen Aufmerksamkeit gelungen.
Einer wünschenswerten deutschen Resonanz könnte die sehr gelungene Übersetzung Andreas Tretners zuarbeiten. Sie hat nur einen amüsanten & kuriosen Fehler. Tretner lässt in seiner Übersetzung eines fiktiven Tagebuchs aus den Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Diaristin gleich zweimal davon berichten, dass sie irgendwohin »gedüst« sei. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in den Fünfzigern einmal modisch erfundene Verb »düsen« (für eine schnelle Bewegung von Menschen, die wie Flugzeuge von Düsen beschleunigt werden) heute noch jemand kennt & versteht. Denn es schien mir ganz & gar außer Gebrauch gekommen zu sein.
Vielleicht ist aber der offensichtliche Fehler des Übersetzers so befremdlich in Schischkins ›Venushaar‹ auch wieder nicht. Denn ein Gegenwarts-Roman, der mit einem unausgewiesenen Xenophon-Zitat beginnt und im nächsten Satz die morgendliche Szene in der Schweizer Ausländerbehörde skizziert, wo in Gegenwart von Polizisten, Beamten & einem Dolmetscher osteuropäische »Gesuchsteller« ihren Asylantrag begründen sollen, fängt ja bizarr genug an.
Ungewöhnlich ist auch seine Fortsetzung: nämlich eine Folge von Fragen & Antworten, in denen Mord & Totschlag, Folter & Vergewaltigung, Drohungen, Flucht & Verfolgung zur Sprache kommen; aber auch durchschaubare Betrugsmanöver, um sich Einlass & Aufenthalt im »Paradies« der Schweiz zu erschleichen, deren Existenz in einer märchenhaften Allegorie an den »Hochwerten Nabuccosaurus« beschworen wird.
Dazwischen: Kaffeepausen des Dolmetschers, der in Xenophons Anabasis liest – jenem autobiographischen Bericht einer griechischen Söldnertruppe in persischen Diensten, die sich im 4. Jahrhundert auf eigene Faust quer durch Kleinasien in die thrakische Heimat durchschlägt. Später im ›Venushaar‹, wenn der Roman im sowjetischen Tschetschenienkrieg Station macht, wird Schischkin in einigen Passagen die Zeiten aufheben, durchlässig machen für einen erzählerischen Grenzverkehr mythischer Wiederholungen im Kaukasus & am Schwarzen Meer zwischen dem 4. & dem 20. Jahrhundert. Christoph Ransmayrs ›Die letzte Welt‹ grüßt dabei von ferne.
Patchwork aus literarischen Zeugnissen
Jedoch bildet die antike Erzählung der Griechen in der Fremde keinen eigenen Erzählstrang in der literarischen Buntscheckigkeit des erstaunlichen Buches aus, das man als eine polyphone Epopöe des Exils, einen erzählerischen Flickerlteppich der Vertreibung bezeichnen könnte. Als Leser, der hier eine erste Bekanntschaft mit dem Schweizer Russen oder russischen Schweizer macht, hat man fast den Eindruck, der mit allen ästhetischen Mitteln des modernen Romans vertraute Michael Schischkin wolle einen mit seiner erzählerischen Virtuosität & spielerischen Vielfältigkeit ebenso imponieren wie verwirren.
Denn man muss schon sehr aufpassen, um beim fliegenden Wechsel, den der Romancier zwischen seinen zeit- & ortsdifferenten thematischen Steckenpferden vornimmt, nicht auf der Strecke zu bleiben & die Orientierung zu verlieren, weil er nämlich dabei sowohl die literarischen Genres als auch die Stile oft blitzartig wechselt.
Neben der immer wieder aufgenommenen, aber variierten Technik von Frage & Antwort, mit der er ein Kaleidoskop von individuellen Lebens- & Leidensgeschichten des Kriegs-Grauens in der Gegenwart evoziert, ist es vor allem zum einen das fiktive Tagebuch der Sängerin Isabella Jurjewa und zum anderen sind es die Aufzeichnungen des Dolmetschers von seiner unglücklich in der Trennung endenden Italien- & Frankreichreise mit seiner Frau und ihrem kleinen Kind, mit denen Schischkin einen multiplen Roman des 20. Jahrhunderts unter russischen Perspektiven entstehen lässt. Hinzu kommt noch als weiterer verdichteter Stoff-Komplex die Beschreibung der demütigenden Zustände in der sowjetischen Armee, die die jungen Soldaten vorab brutalisiert, bevor sie in den Horror des gnadenlosen Kriegs in Afghanistan & Tschetschenien geraten, dessen Gräuel sie traumatisiert.
Die lange Lebensspanne von rund 90 Jahren, welche die aus bürgerlichem Elternhaus stammende Sängerin von ihrer pubertären Jugend im zaristischen bis ins postsowjetische Russland durchlebt, erlaubt Schischkin, die wechselnden Erlebniswelten während eines Jahrhunderts im Spiegel der sich verändernden Tagebuchaufzeichnungen aus weiblicher Perspektive zu reflektieren. Jedoch die politischen Entwicklungen der Sowjetunion nach dem Ende des blutigen Bürgerkriegs – also vor allem die terroristische Zeit des Stalinismus und der »Große Vaterländische Krieg« – spielen in der Wahrnehmung der als »unpolitisch« gezeichneten & ganz ihren erotischen Emotionen als Frau & Mutter lebenden Künstlerin keine Rolle, was einen denn doch einigermaßen irritiert.
Furioser Kehraus der Motive in Rom
Der Autor, der sich offensichtlich (nicht zu Unrecht) einiges darauf zugutehält, als Mann ein Frauenleben trefflich literarisch imaginieren zu können, hat allerdings dabei seinem Affen etwas zu viel Zucker gegeben, will sagen: Die sentimentalen Aufwallungen der über ihre unerfüllten und erfüllten Liebesbeziehungen besorgten Diaristin nehmen im Mittelteil des Romans einen zu großen, vor allem redundanten Raum ein.
Man hätte jedoch immer noch keinen annährenden Eindruck von der Vielzahl der Themen und deren literarischen Instrumentierung durch Schischkin, wenn man jene Erzählstrecken verschwiege, auf denen er disparate und z.T. surreale Szenen in wenigen Zeilen um- oder anreißt & sie hintereinander so montiert, dass er damit einen kaleidoskopischen Wirbel von grausamen, märchenhaften, grotesken und absurden Momentaufnahmen erzeugt.
Nahezu unerkennbar aber bleiben für den nicht-russischen Leser die zahlreichen »Fiorituren & Pralltriller« (Arno Schmidt), die der hochgebildete Autor prunkvoll, hintersinnig und gewitzt als Zitat-Lichter seinem Text aufgesetzt hat – vornehmlich aus der russischen Literatur- & Kulturgeschichte, aber auch aus der europäischen & antiken Geisteswelt. Auf einige dieser Anspielungen hat der Übersetzter auf 17 (!) Seiten im Anhang hingewiesen.
Je mehr das Buch sich dem Ende zuneigt und in einem apokalyptischen Furioso vieler seiner Motive in Rom ausklingt, desto stärker tritt ein philosophisch-mystischer, fatalistisch-religiöser Zug an Michael Schischkins epischer Weltsicht zutage, der einmal so beschrieben wird: »Jemandem wird der Kopf abgeschlagen, und in der Menge der Zuschauer vor dem Schafott sind zwei, die verlieben sich gerade zum erstenmal. Einer schaut verzückt auf den malerischen Sonnenuntergang, ein anderer sieht ihn auch, aber durch ein Gitter.(…) Die Welt ist ein Ganzes, eine Vielzahl kommunizierender Gefäße. Je ärger das Unglück des einen, desto entschiedener müssen die anderen auf ihrem Glück bestehen. Desto stärker müssen sie lieben. Damit die Welt im Gleichgewicht bleibt, damit sie nicht kentert wie ein Boot.«
Eher ist es die Ahnung, dass Michael Schischkin hier etwas Außerordentliches literarisch gelungen ist, als die begründete Gewissheit, es sei so, die mich motiviert, jedem Liebhaber einer aufs Ganze gehenden epischen Moderne dieses dichte, auch rätselvolle ›Venushaar‹ zur Lektüre zu empfehlen. Es ist jedenfalls höchste Zeit, dass wir einen einzigartigen Autor kennenlernen, der unter uns lebt.